
[Radde, Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländern] Kapitel 1 Abs. V.
Erstes Kapitel. Die Steppen der Kaukasusländer.
V. Formationen der Steppen, geschildert auf Grundlage einer Reise von Wladikawkas entlang der Kuma bei Wladimirowka und von da über Mosdok nach Wladikawkas.
Flora der Schwarzerdesteppe S. 35. Uferwäldchen in der Steppe S. 39. Wermutsteppe S. 41. Pappel- und Weidengehölze der Flussniederungen S. 44.Distel- und Sisymbrium-Steppen S. 45. Flachssteppe S. 47. Wandernde Sandsteppe S. 47. Mohnsteppe S. 49. Die Niederungen der Sunsha und des Terek mit Baum- und Buschbeständen S. 50.Gemischte Steppe S. 50. Dürftiges Buschgehölz in den nördlichen Vorbergen des Kaukasus S. 51. Von Wladikawkas zum Terek-Delta S. 52.Paliurus-Bestände S. 54. Der Burian S. 57. Tamarix-Gebüsch und Iris-Steppe S. 58. Alluvial-Flora des Terek S. 58. Steppenflora im Terek-Delta S. 59- Abschweifung in das Flachland zwischen der Wolga und den Jergeni-Höhen S. 59. Schwemmwiesen zwischen Wolga- und Terek-Delta S. 60. Halophyten-Flora S. 62. Typische Wermutsteppe S. 63. Flora der Sandbarchanen S. 65. Flora der Jergeni-Höhen S. 66. Steppe zwischen Kisljar und dem S'ulak S. 69. Hungersteppe in der Niederung des S'ulak S. 72. Steppenflora am unteren Nordabhang des Gebirges bis zu 300 m (1000 r. F.) S. 72. Recente Kaspi-Reste als Unterlage für die Hungersteppe S. 75. Dünen- und Halophyten-Vegetation am Temirgoje-See S. 75. Dünenflora am NO.-Fuße des Kaukasus am Kaspi S. 77. Wanderungen transkaukasischer Arten in der Uferzone S. 79. Schlussfolgerungen S. 81.
Nach diesen vorangeschickten Bemerkungen allgemeinen Inhaltes gehe ich jetzt an die Spezialschilderung derjenigen Steppen, welche sich in der östlichen Hälfte des Kaukasus von seinem Fuße gegen Norden unabsehbar erstrecken und in ihrem südlichen Teile von der Kuma und dem Terek durchschnitten werden. Ich bereiste sie im Interesse dieses Werkes zum letztenmal im Sommer 1894. Die Zeit, in welcher ich diese Schilderungen niederschrieb, gehört der Mitte des Maimonats nach n. St. an. Die Lokalität, auf welche sie sich beziehen, umfasst zunächst den Nordfuß des Kaukasus, soweit ihm die Terekzuflüsse in der Ebene angehören, und den Lauf der Kuma mit Ausschluss ihrer Quellen. Ostwärts durchschnitt ich endlich direkt von N. nach S. die Nogaier Steppe, als ich am 19. Mai die [p.35:] Strecke von Wladimirowka bis Mosdok und von da nach Wladikawkas zurücklegte.
Flora der Schwarzerdesteppe. Das erste Entwicklungsstadium der Steppenflora im Frühlinge traf ich am Nordfuße des Kaukasus bei Wladikawkas um diese Zeit nicht mehr an. Es beginnt, wie überall anderwärts, so auch hier mit den Zwiebelgewächsen. Muscari racemosum, M. botryoides, Ornithogalum umbellatum, Gagea arvensis, G. lutea, G. pusilla und G. minima, Merendera caucasica erwachen am frühesten. Gleichzeitig mit ihnen sehen wir Iris pumila, I. reticulata und Crocus variegatus, dazu eine Anzahl zierlicher Cruciferen, wie Alyssum minimum, A. calycinum, Meniocus linifolius, Erophila verna und hier auch Draba nemoralis, dann Veronica agrestis, V. arvensis, V. verna, denen sich überall Androsace maxima und Erodium cicutarium zugesellen.
Zwischen den kräftigen Wurzelblättern etlicher Salvia- und zweier Phlomis- Arten und dem frisch hervortreibenden Grün der zeitigen Gramineen (Poa bulbosa und annua und Bromus) bringen frühe Jahre schon Mitte März trotz der Meereshöhe von über 600 m (2000 r. F.) die ersten Blumen dieser Gewächse. Es folgen ihnen in Monatsfrist Tulipa Gesneriana und Muscari comosum; einige der vorhergenannten Arten blühen bis Ende April und während dieser Zeit entwickeln sich sowohl die Gramineen als auch die Grundblätter der Staudengewächse.
Schon in etwa 10 km Entfernung von Wladikawkas gegen Norden verschwindet mehr und mehr die jetzt saftig grüne Grassteppe, besser gesagt Grasflur, welche sich, unmittelbar am Fuße des Gebirges beginnend und sich vornehmlich aus Gramineen aufbauend, nordwärts hin erstreckt. Man muss nicht vergessen, dass ehedem die Wälder vom Nordabhang des Kaukasus viel weiter in die Ebene traten, als das jetzt noch der Fall ist, dass zwischen Terek und Sunsha noch zu Anfang des Jahrhunderts geschlossener Laubholzwald stand, der während der langen Kriegszeit gegen die Bergvölker absichtlich mehr und mehr gelichtet und streckenweise ganz vernichtet wurde, von dem sich aber hier und da noch Spuren und krüppelnder Nachwuchs erhielten. Es haben sich aus jener Zeit manche Waldgewächse, welche der ursprünglichen Steppe anderweitig fehlen, in diesen Ebenen erhalten. Wo diese Grasfluren unberührt bleiben, zeichnen sie sich durch die merkliche Abnahme hoher Stauden aus, die anderweitig, sei es nun, dass sie ausdauern oder auch nur als Sommergewächse, so augenscheinlich die saftig grüne Fläche überragen. Wohl sieht man den Wegen und der Eisenbahn entlang die Grundblätter von Arctium, von Sambucus Ebulus und geschlossene Brennesselkolonieen, weiter seitwärts hin diejenigen hoher Inula-Arten, auch strebt hier und da, kerzengleich, der Blütentrieb von Verbascum phoeniceum oder der noch schlankere von Turrites glabra hervor, aber der Gesamteindruck ist der einer gleichmäßigen, üppigen Grasflur. Ab und zu machen sich darin dunkelblaue Flecken bemerkbar, sie sind tief lasurfarben, aber nicht fest zusammenhängend. Da blüht Vinca herbacea, die wir, soweit Schwarzerde reicht, immer sporadisch wiederfinden. An anderen Stellen beginnt die hochwachsende Veronica melissifolia sich durch [p.36:] ihre türkisblauen Blumenstände in Ährenform bemerkbar zu machen, und die beiden kräftigen Euphorbiaarten (E. agraria und E. iberica) schauen aus dem Grasgrün mit ihren kaum erschlossenen, hochgelben Blütenständen hervor; auch sie bevorzugen die Schwarzerde, werden auf Lehmboden kümmerlich und fehlen dem leichten, sandigen Terrain ganz. Es ist bemerkenswert, dass Primula officinalis in der typischen Kelchgröße weit in die Steppe vortritt, aber doch nur immer an solchen Stellen, wo dürftiges Eichengebüsch und Schlehen (Prunus spinosa), die jetzt blühen, noch wachsen. Weiterhin verschwindet sie vollständig, ist aber gleich wieder da, wo an Flussrändern oder auf Inseln noch kleine Wäldchen erhalten blieben. Ebenso verhält es sich mit Fragaria elatior. Schaut man genauer in das förmlich flutende Grasmeer, so bemerkt man darin manche an und für sich unscheinbare Pflänzchen, die aber alle mehr oder weniger an die Flora der Waldränder erinnern und hier physiognomisch gar nicht zur Geltung kommen. Da giebt es Stellen, auf denen Stellaria media wuchert, andere weisen das kräftige Cerastium nemorale auf. Anderweitig gruppierte sich Myosotis hispida und sogar M. palustris, zumal in der Nähe von Krüppelgesträuch. Selbst Alchemilla vulgaris ist, so lange wir uns nicht gar zu weit vom Gebirgsfuße entfernen, nicht selten und als Gast, von den Höhen eingewandert, findet sich sogar Ran. Villarsii. Zu jenen zarteren Pflänzchen, welche sich im Schutze dichter Graspolster offenbar Wohlbefinden, gehören auch Draba nemoralis und Dr. tridentata, sowie Veronica filiformis, deren langgestielte, milchblaue, große Blüten immer vereinzelt aus der grünen Unterlage hervortauchen, während sich V. chamaedrys durch die lockeren Blumenähren viel bemerkbarer macht und Ajuga reptans, am Boden hinkriechend, die dichten, blauen Blütenstände hochhält. Blühende Barbarea vulgaris malt hier und da intensiv gelbe Flecken ins Grüne, aber das leuchtende Rot einer Mohnblume (Pap. hybridum) ist hier nur vereinzelt und vom reizenden Tulpenflor sah man jetzt gar nichts mehr.
Wo im vorigen Jahre Mais- oder Sonnenblumenfelder standen, haben sich die toten Stengel dieser Kulturpflanzen erhalten. Die gelbgraue Maisstoppel knickte obenher oft zusammen, dauerhafter blieben die hohen Strünke der Sonnenblumen, an denen oben einzelne verspätete Blütenköpfe auftrockneten und während des Winters pechschwarz wurden. Es fällt auf, dass das lästige Xanthium spinosum, welches doch, wenn auch tot, so standhaft den Winter erträgt, hier nirgend gesehen wird, es scheint zu fehlen, sonst würde es auf Brachfeldern und an Wegrändern zu sehen sein, denn seine struppigen Leichen erhalten sich lange, sind braungelb und tragen die behakten, ovalen Samen fest an dem Geäste. Auch Polygonum aviculare, welches auf weite Strecken hin anderweitig ausschließlich die breiten Wege bedeckt, sah ich hier nicht. Dagegen wanderten Plantago major und Pl. lanceolata, namentlich letzteres, getreu den Wegen entlang und standen in voller Blüte. Auf dem guten Boden hatte Pl. lanceolata nicht selten 2 Fuß hohe Blütenstengel, an deren Spitze je die gedrängte Blumenwalze grauglänzend schimmerte. [p. 37:]
Schon in der Entfernung, von reichlich 10 km von Wladikawkas verliert die Steppe ihren üppigen Grastypus. Der Terek nimmt von links her eine große Anzahl gut gespeister Zuflüsse auf, alle haben den Charakter arbeitender Gebirgswasser. Man sieht unter kaum fußdicker und leichterer, oberflächlicher Erdschicht feines Gerölle und Sand. Zumal ist das an den beiden größten westlichen Zuflüssen, am Baksan und an der Malka der Fall. Reichlich sind die Niederungen der genannten Wasser mit Weiden bestanden, auch Schwarzpappeln und Espen bemerkt man, sowie krüppeliges Eichengebüsch, dessen kaum etwas aufgerolltes Blattwerk jetzt (14. Mai) gelbkupferig erscheint. Aber die großen Bouquets von Conv. majalis, welche man auf den Stationen von Echotowa bis Kotlarewskaja für ein Billiges zum Kauf anbot, waren nicht in der Steppe, sondern im Walde der beiden oben erwähnten Sunsha-Terek-Gebirge, die man hier durchschneidet, gepflückt worden. Fast alle wirklich charakteristischen Steppenarten sind scharf von der Waldflora abgeschnitten und ebenso übertreten die meisten der typischen Waldformen nicht gerne das ihnen von der Natur angewiesene Gebiet, wie wir das später bei dem Besuche der Wäldchen an dem Podkumok speziell nachweisen werden. Sehr bedeutend vorgeschritten war die Vegetation bei der Station Kotlarewskaja (219 m =718 r. F.), die angepflanzten Heckenakazien (Caragana arborescens) standen in voller Blüte, die Weiden und Pyramidenpappeln trugen das volle Laub, die Fiederblätter von Robinia Pseudo-Acacia hatten halbe Größe.
Die Ebene der linken höheren Terekseite ist meistenteils mit Krüppeleichen bebuscht. Rechterseits ragt junges Rohr über die Sumpfflächen des ausgetretenen Flusses. Auf dem mageren Boden wogten stellenweise die lockeren Blütenstände von Poa-Kolonien (Poa bulbosa) und weiterhin färbte das leuchtende Rot von Papaver hybridum eine große Fläche, dessen einzelne Blumen sich durch die großen schwarzen Augenflecken an der Basis der Petala so charakteristisch kennzeichnen. Daneben das Dottergelb von Barbarea, das Türkisblau der genannten Veronica-Art und hoch über dem Grün die ersten erschlossenen Kronen von Linum austriacum. Die alte Brache trägt das der eigentlichen Steppe zukommende Buriangestrüpp des vorigen Jahres auch jetzt noch zum größten Teil wohlerhalten. Aus knäuligen, niedrigen Centaureen, aus Eryngium campestre und höheren Carduus-Arten bestehend, liegen mitten in der frühlingsgrünen, in scharfen Umrissen und intensiven Farben kolorierten Steppe diese großen, dunkelbraunen Totenfelder. Zu Füßen der starren Pflanzenleichen entdrängt neues Leben dem Boden, aber für die Physiognomie des Ganzen kommt es jetzt an solchen Stellen noch nicht zur Geltung.
Weiterhin nach Prochladnaja wird der Boden ärmer, schon erscheint der Wermut (Artemisia maritima) [und Art. fragrans, welche salziges Terrain bevorzugt.] und nur niedrig blieben die Gewächse. Streckenweise sieht man nur die blaugrauen Grundblattköpfe des Wermuts. Mit dem Übergange der niedrigen Wasserscheide zwischen Terek und Kuma, auf der Strecke Weges von Solskaja bis Neslobnaja bleibt in Bezug auf die [p.38:] Vegetation alles Strenge im Steppentypus erhalten. Ab und zu taucht Paeonia tenuifolia mit ihren dunkelroten Blumen auf, aber nirgends sieht man eine Tulpe. Der Boden wird wieder schwer. Bei der Station Neslobnaja befindet man Sich ungefähr 300 m (980 r. F.) über dem Meere und wendet nun nach Osten, um nach dem in 314 m (1032 r. F.) gelegenen Georgiewsk zu kommen. Hier betreten wir erst die wirkliche Steppe und zwar die schwarzerdige, zum Teil noch gar nicht oder nur wenig bearbeitet. Wie überall so folgt auch hier dem Wege das Bilsenkraut, jetzt in einzelnen 2 Fuß hohen Stauden, die noch nicht blühen. Diese Steppe ist streckenweise ausschließlich mit Chorispora tenella bedeckt. Nirgends sieht man an solchen Stellen eine vegetative Narbenbildung, überall freier, schwarzer, noch nicht geplatzter Boden, in welchem noch vor kurzem, als es anhaltend regnete, die Räder der Fuhrwerke tief einschnitten. Seitwärts vom Wege liegen hart am Boden in den Chorisporaflecken die behaarten, großen Blattrosetten von Salvia aethiopis, oder es erheben sich 1—2 Fuß hohe Stauden von Phlomis tuberosa, deren kräftige dunkle Belaubung die einzeln stehenden Exemplare recht auffallend macht und an denen schon die achselständigen Blumenknospen stark geschwollen sind. Dazwischen überall Gruppen verschiedener niedriger Cruciferen mit reifen Samenständen. Namentlich sind es die weitverbreiteten Arten: Alyssum minimum und Meniocus linifolius. Sie sind samt den runden, fast platten Schötchen schon vergilbt. Dazwischen macht sich hier und da A. calycinum bemerkbar, und ab und zu sieht man niedrige Muscari-(M. racemosum-)Stengel mit den Samenkapseln. Hier auch überall in kleinen Gruppen Ran. oxyspermus, größere Plätze behauptet Capsella bursa pastoris und gerne die Ränder des Weges suchend hat Falcaria Rivini schon die Grundblätter ganz entwickelt. Größere Plätze bedeckt Lepidium Draba, an welchem vereinzelt die ersten weißen Blüten sich erschließen. Weithin verstreut über die flache Ebene leben beide Lithospermum-Arten, L. officinale und L. arvense. Anchusa arvensis und Melandryum pratense samt Euphorbia iberica sind überall mehr vereinzelt verteilt, aber Vinca herbacea und Fragaria elatior existierten auch hier und entsende ten ihre seitlichen Absenker über den Boden.
Mit der Nähe des Flüsschens Podkumok wird die Flora besser. Ajuga genevensis steht in voller Blüte, Barbarea vulgaris und Papaver hybridum werden immer nur einzeln oder in wenigen Exemplaren beisammen gesehen. Thalictrum elatum trieb das saftig grüne Blattwerk hervor und erreichte schon mehr als 2 Fuß Höhe, unweit von ihm erscheinen im Gegensatze des Kolorits die Marrubium-Gruppen im matten Graugrün und noch mehr ins Bläuliche ziehend machen sich die jungen, fein zerschlitzten Grundblätter von Artemisia maritima? (jetzt nicht zu erkennen) bemerkbar, welche letztere Art hier noch wenig vorkommt, weiter nach Osten aber große Gebiete fast ausschließlich besiedelt. Nicht anders verhält es sich mit Achillea pubescens, der wir bald viel häufiger und auch weiter vorgeschritten in der Entwicklung begegnen werden. Chorispora tenella verschwindet ganz, nur vereinzelt wird Lepidium perfoliatum bemerkt. Immer isoliert, hat Verbascum phoeniceum den hohen [p. 39:] Blütenstand hervorgeschoben, an ihm prangen die großen, violetten Kronen, die rosa Varietät, wie sie der Norden Deutschlands kennt, sah ich nirgends. Vervollständigen kann ich diese Pflanzensuite noch durch Veronica austriaca, Thesium ramosum, ja sogar durch Thymus serpyllum mit breiter Blattform. Von den Gräsern ist allenfalls Poa bulbosa var. vivipara zu erwähnen, welche in dieser Höhe erst zu blühen beginnt und, wo sie häufiger beisammen steht, leicht vor dem Luftzuge sich wiegt.
Uferwäldchen in der Steppe. Von allen den genannten Pflanzen fanden wir in den so nahe gelegenen Wäldchen auf der anderen Uferseite des kaum 40 Schritte breiten Podkumok fast nichts. Möglich, dass Thalictrum und Ajuga, auch wohl Melandryum bis über seinen äußersten Rand vordringen, aber die echten Steppenformen sind dem Walde fremd, und ebenso überschreiten die echten Waldformen hier nicht die Randzone der schattenden Gehölze. Diese interessanten Wäldchen will ich hier einschaltend ausführlicher besprechen. Es sind die letzten, welche wir bei unserem weiteren Wege gegen Osten antreffen, denn die dem Terekufer entlang laufenden Weiden- (S. fragilis) und Pappelgehölze (P. alba) und sonstige Anpflanzungen verdienen solche Bezeichnung nicht.
Gleich am Rande des Waldes hatte sich unter hohen alten Weiden Rubus caesius in größeren Gruppen angesiedelt. Aber schon wenig weiter lernte ich die eigentlichen Bestände dieser Gehölze kennen. Es giebt darin gar keine alten Bäume. Man sagte mir, dass solche ehedem existiert hätten, aber noch vor der Russenherrschaft niedergehauen wurden. Höhere alte Wurzelstöcke sieht man nirgends, wohl aber oft mehrere junge Triebe, die einem kaum über dem Erdreich hervorragenden alten Träger angehören. Bäume von 1 Fuß Durchmesser an der Stammbasis sind selten, das meiste ist hochstrebendes Stangengeholz, aber überall steht es dicht und hat da, wo es gereinigt wurde, gesundes Ansehen und 4—5 Zoll Stammdicke. Dieser Wald bedeckt ein Areal von 100 Desjt, er gehört seit 25 Jahren dem General Sofonow und wird, zum Lobe sei es gesagt, geschont und durchaus rationell bewirtschaftet. Man schlägt nur schadhafte Stämme, säubert und reinigt überall. Eichen (Q. sessiliflora) und Rüstern, letztere oft mit korkiger Rinde, sowie Weiden walten der Zahl nach vor. Eschen und Linden, T. platyphylla Spp., Wildbirnen, Acer campestre und Carpinus Betulus bemerkt man weniger häufig. Das Unterholz wirc wesentlich von Corylus avellana, Prunus cerasus, P. divaricata und Pr. spinosa, von Crataegus sp., von Evonymus europaeus und verrucosus, Rhamnus Pallasii, Cydonia vulgaris, hier und da auch von Viburnum opulus und Ligustrum vulgare gebildet. Von Zapfenbäumen keine Spur. Schlinger sind drei vorhanden, nämlich der wilde Hopfen, Periploca graeca und auffallenderweise die Rebe. Sie überdauert hier noch in über 300 m (1000 r. F.) Meereshöhe die Minimaltemperatur von 25° C. und litt sogar im Jahre 1888 nicht, als der ausnahmsweise harte Winter dem Walde vielen Frostschaden brachte. Es ist das um so erwähnenswerter, als die kultivierte Rebe überall bis in die kaspische Niederung (Kisljar) hinein für den Winter gedeckt werden muss. Höchstens [p. 40:] fingerdick im Holz rankt die Rebe hoch, aber nur jahrweise reift an ihr die Traube. Wo man den Wald reinigt, beseitigt man sie. Dass nicht selten junge Triebe abfrieren, wurde durch eine Anzahl toter Rebenstränge bestätigt, aber sie bleibt wurzelhart und treibt aufs neue. Lonicera Caprifolium sah ich nur wenig und niedrig.
Speziell die Krauter des Bodens anlangend, so sammelte ich am 16. Mai folgende Arten (Die mit einem * bezeichneten gewöhnen sich in breiter Zone am Nordfuße des Kaukasus am ehesten an die Steppe. Ran. oxyspermus hat sich von der Steppe an den Wald gewöhnt.):
Chaerophyllum aureum L.
*Galium Cruciata (L.) Scop., äußerst üppig.
Galium Aparine L.
*Valerianella olitoria (L.) Poll., über 1 Fuß hoch.
Scilla cernua Red. in Samen, sehr üppig.
Lamium album L.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus oxyspermus Willd.
Dentaria bulbifera L.
Corydalis Marschalliana Pall.
Lithospermum purpureo-coeruleum L.
Myosotis sparsiflora M. K.
Cynoglossum officinale L.
*Primula officinalis (L.) Jacq.
*Hesperis matronalis L.
Tussilago farfara L.
Geranium pusillum L.
Arum Orientale M. B. (?).
*Cerastium nemorale M. B.
Viola Besseri Rupr.
Carex Michelii Host.
Carex riparia Curt.
Carex divulsa Good.
Melica nutans L.
Phleum pratense L.
Einige Steppenformen, wie z. B. Echinospermum Lappula, Marrubium peregrinum und die Schuttpflanze Leonurus cardiaca folgten anfänglich dem breiten Wege, verschwanden aber im Schatten. Wie man aus dem Verzeichnis sieht, so ist Artenarmut beiden Gebieten eigen, und die Mehrzahl der vorhandenen Spezies schließen sich in scharfer Abgrenzung gegenseitig aus. Nicht anders verhält es sich damit in Bezug auf die Faunen. An den glatten Stämmen von Fraxinus excelsior klebten bis hoch in die Kronen viele Helix atrolabiata, die in der Steppe ihr Äquivalent in H. obtusata besitzt, und unter dem lockeren Laube lebte eine Anzahl von solchen Chondrus-, Bulimus- und Clausilia-Arten, die man in den Steppen nicht findet. Die genannten Frühlingskräuter hatten fast alle abgeblüht, zu Boden geneigt lagen die reifenden Kapseln der Veilchen und Scillen, Corydalis gelbe an den Spitzen und starr ragten die schmalen Schoten seitwärts am Stengel von Dentaria hervor, ihre Wurzelblätter waren stark zerfressen. Die Kätzchen an den Eichen trockneten schon ab, die Rüstern streuten den Samen, Acer campestre war verblüht und die Eschen nur schwach belaubt. Der ganze Wald warf in seiner jetzigen Entwicklung nur Halbschatten auf den lehmigen Sandboden. Drei Moose gediehen in diesen Wäldern ausgezeichnet, namentlich hatte Leskea polycarpa am Grunde der Bäume schöne, lebhaft grüne Polster geformt und von verrotteten Wurzel [p. 41:] stöcken, wo Anomodon viticulosus und Amblystegium fallax beisammen wuchsen, wurden große Stücke mit Leichtigkeit gehoben. Dagegen fehlte Thuidium recognitum, welches mit seinem lichtgefügten Gewebe die Felsen in den schattigen Wäldern hellgrün überzieht, hier, wahrscheinlich weil es keine Felsen gab.
Wir kehren nun wieder in die Steppe zurück.
Auf der weiten Strecke, die man, immer dem Laufe der Kuma folgend, zuerst in der Hauptrichtung NO., später ganz O. bis nach Wladimirowka zurücklegt und auf der man sich dabei von 300 m (1000 r. F.) Meereshöhe bis ca. 100 m (350 r. F.) herablässt, ändert die Steppe mannigfach ab. Der Boden wird in dieser Richtung, je mehr nach Osten, um so leichter und bietet zuerst alle Übergänge von der Schwarzerde zum rotgelben, plastischen Thon und zuletzt zum sandigen grauen Lehm.
Wermutsteppe. Da dehnen sich vor uns unabsehbare Ebenen, vom weitentfernten nördlichen Horizont geradlinig umgrenzt, hier und da kaum durch vereinzelte Tumuli schwach wellig angeschwollen. Die Wermutsteppe behauptet mit unbeugsamer Zähigkeit ihr weites Reich. Die graugrünlichen, jungen Wurzelblattgruppen, welche die ausdauernden, flachköpfigen Stöcke hervortrieben, haben matten Silberglanz, ein weiches, kurzes Haarkleid hüllt die schmalzerschlitzten Blätter ein. Aus ihnen ragen bis 2 Fuß Höhe die spirrigen, vorjährigen Blütenstengel hervor. Schwärzlich grau sind sie. In ihrem Geäste ließen durchwandernde Schafe und Kamele Wollflocken hängen, hier und da spannte ihr dichtes Fangnetz eine Spinne daran aus. Tot, soweit das Auge reicht, gleichmäßig grauschwarz im Gesamtkolorit, erscheint auch jetzt im Mai die Wermutsteppe, denn das wenige aus dem Boden hervorsprießende Grün kommt für den Beobachter nur in unmittelbarer Nähe zur Geltung. Zwischen den einzelnen Wermutstöcken entsprossen dem kahlen, lehmigen Boden die winzigen Frühlingscruciferen, Alyssum minimum und Meniocus linifolius, welche bereits abstarben. Hier und da kümmerliche Lagoseris (Pterotheca) bifida, einige Echinospermum-Gruppen, Lepidium perfoliatum. Auch kleine Strecken mit Euclidium syriacum, doch sieht man den schwächlichen Individuen an, dass sie sich nicht Wohlbefinden. Die Wermutsteppe ist gewöhnlich scharf umgrenzt, zwar treten an den Rändern derselben vereinzelt andere Pflanzen auf, aber sie kommen nicht zur Geltung. Sowohl das maßgebende Lepidium Draba, als auch beide Achilleen (Ach. micrantha und Ach. pubescens) wachsen in mehr oder weniger geschlossenen Kolonieen und vermeiden die zusammenhängende Wermutsteppe. Offenbar behaupten und erweitern sie das einmal eroberte Gebiet. Nur an wenigen Stellen und zwar an solchen, die nahe dem hohen, linken Kumaufer gelegen, hatte sich sogar hier in der Wermutsteppe Sambucus ebulus niedergelassen. Aber augenscheinlich konnte die lästige Staude sich mit ihren ausdauernden Wurzelstöcken kein größeres Terrain erobern. Abgerundete Flecken von etwa 7—8 m Durchmesser nahm sie ausschließlich ein. In den trockensten Wermutsteppen bewohnt bisweilen Cladonia endiviaefolia in großer Zahl den Boden. Die rein weiße Flechte malt dann zwischen dem [p. 42:] grauen Wermut unregelmäßige Flecken, die sehr in die Augen fallen. An ähnlichen Plätzen fand ich sie auch in den Ebenen von Transkaukasien, so bei Jewlach und am Bos-dagh-Fuße. In solchen äußerst trockenen Gegenden zerbricht sie unter der Hand.
Für die Folge treten, wenn wir immer diejenigen Arten im Auge behalten, welche durch ihr massenhaftes, oft enge abgeschlossenes Vorkommen für den Vegetationscharakter der Steppe maßgebend werden, außer Lepidium Draba und Achillea pubescens auch noch Euclidium syriacum namentlich den Wegen entlang in fast ganz reinen Beständen auf. Von Polygonum aviculare, die das anderweitig auch thut, sehe ich auf dieser Strecke gar nichts. Auch Xanthium spinosum wurde zum erstenmale erst östlicher (auf dem Wege nach dem Dorfe Soldatsko-Alexandrowskoje) bemerkt, und zwar stand es auf einem schmalen Streifen alter Brache, welche die vor dem Herbststurm hinfliegenden, behakten Samen am ehesten an den aufgeworfenen Erdschollen festzuhalten im Stande war. Die struppigen, oft knäuelförmig in einander gewehten Leichen dieses wandernden Steppenunkrautes trugen noch alle ihre bewaffneten vorjährigen Samen und hatten jetzt eine fast schwarze Farbe. Jedenfalls wird mit der Einwanderung der Kamele —, welche neuerdings aus dem Orenburgischen hier eingeführt werden, weil das Rind zu oft der sibirischen Pestseuche verfiel –, auch Xanthium spinosum bald allgemein verbreitet sein. Es ist ja nachweislich durch Kamele an die Südküste der Krim und über den Kamm des Großen Kaukasus in die transkaukasischen Gaue und nach Persien gebracht worden. Auf dem Streifen Brachlandes, die es hier beherrschte, sah ich keine sonstigen Burianpflanzen.
In den erwähnten Lepidium- und Achillea-Arten entwickeln sich, ebenfalls in gesellschaftlichem Abschlüsse, einige Frühlingsgramineen. Von ihnen tragen durch Masse und Habitus Bromus tectorum und Poa bulbosa vivipara streckenweise wesentlich zur Physiognomie der Gesamtflora bei. Vor dem scharfen Ostwinde wogen die über 1 Fuß hohen lichten Ähren von der erwähnten Bromus sp. im Silberschimmer, ihre spitzen, langen Grannen sitzen auf der erweiterten, glänzenden Basis. Ebenso wiegt es in den hinfälligen, geschmeidigen Poa-Beständen, die jetzt schon, sobald wir uns in 210 m (700 r. F.) Meereshöhe befinden, absterben und deren oft überladene Ähren, wie bei fruchtreifer Hirse, abwärts geneigt sind. Die beiden Agropyrum-Arten (Agr. Orientale und Agr. prostratum) tragen wenig zur Veränderung des Gesamtbildes dieser armseligen Steppen bei. Sie blühen jetzt, sind steif und widerstehen dem scharfen Luftzuge. Gerne folgt Agropyrum prostratum dem Wege und besiedelt auch die Erddächer der niedrigen Häuser, während Agr. Orientale der trockenen, höher gelegenen Steppe am linken Kumaufer angehört. Ebenso wenig kommt Sclerochloa dura zur Geltung. Diese niedrige, hart; Grasart, die den Boden kaum 4—6 Zoll überragt, nimmt mit steifem, trockenem Lehm vorlieb und scheut auch in ihm einen gewissen Salzgehalt nicht. Es wechseln also die Achilleen mit Lepidium Draba ab, sie halten sich gesondert, in ihre Reviere tritt mancherorts Artemisia maritima und sucht sie zu [p. 43:] verdrängen. Zwischen ihnen liegt hart am Boden Erodium laciniatum, entsendet die fußlangen Triebe nach allen Seiten und reift schon die 4 Zoll langen Carpelle, in welchen in enger Spirale aufgewunden die Grannen oben am Samen sitzen. Auch sein Gattungsgenosse, E. cicutarium fehlt nicht, es ist eines der frühest blühenden Steppengewächse und überdauert die spätere Hitze, denn schon Ende März blüht es in den Tiefsteppen bis in den Sommer und zum zweitenmale oft wieder im November. Ebenso kauert hart am Boden Medicago minima. Neben dem häufigeren, aber immer licht verstreuten Ranunculus oxyspermus macht sich auch Glaucium corniculatum vorteilhaft bemerkbar, und nicht weit davon steht eine lockere Gruppe von Lepidium perfoliatum, zu gering in der Ausdehnung, um das botanische Antlitz der Lokalität zu beeinflussen. Noch sei gesagt, dass ich auf dieser Strecke nirgends eine abgeblühte Tulpe, ein Muscari, Ornithogalum oder Gagea fand. Dagegen nahm
Stipa pennata in Inselform kleine Plätze ein, doch nirgends deckte sie, wie in den pontischen Gebieten und im NO. vom Asow'schen Meere fast ausschließlich den jungfräulichen Steppenboden. Stipa-Steppen in solcher Ausdehnung, wie sie dort üblich sind, findet man in den Terek-Kuma-Ebenen nirgends und ebensowenig im gesamten östlichen Transkaukasien. Erst oben auf der Arax-Euphrat-Wasserscheide, in reichlich 1980 m (6500 r. F.) Höhe giebt es auf dem ariden Gebiete der Kurden, westlich vom Balyk-göl-See wirkliche exklusive Stipa-Hochsteppen, welche von Stipa Szowitziana gebildet werden. So lange die Steppe entlang dem höheren linken Kumaufer hart und lehmig bleibt, kann man von einer wesentlichen Veränderung ihrer Flora nicht gut sprechen. Der in dieser Jahreszeit fast beständig scharf wehende Ost und Südost trocknet das Erdreich rasch aus. Die Pflanzen schmachteten jetzt, Mitte Mai bereits, selbst die Leinsaaten, die hier im großen Maßstabe fast ausschließlich gebaut werden, hatten in den 3—4 Zoll hohen Trieben einen bedenklich gelben Ton in Folge der Dürre angenommen. Vereinzelt traten bereits die für die weiter östlichen Gegenden so charakteristischen Pflanzen auf, es waren Sisymbrium Loeselii und Carduus uncinatus, aber erst jenseits vom Dorfe Archangelskoje, auf der Strecke Weges nach Praskowja, wo der Boden viel leichter und sandiger wird, konnte das Eingreifen von Peganum harmala in die Steppenflora konstatiert werden. Zwar wird diese Pflanze dann ostwärts mit der Wendung der Kuma in dieser Richtung häufiger, aber nirgend ausschließlich oder in voller Herrschaft über alles andere.
Nirgends überhaupt im Kaukasus sah ich so reine und unabsehbare Peganum-Bestände, wie vor 44 Jahren, als ich die Krim durchwanderte und im Norden von Karasubasar ostwärts zum Faulen Meere (Siwasch) schritt. Hier, in den Kuma-Steppen, sieht man nirgends die Ebene bis zum fernen Horizont von P. harmala bedeckt, es sind immer nur sporadische Flecken, die von ihr gefüllt werden. Den ausdauernden Wurzeln war jetzt das dunkle, zerschlissene Blattgrün in vielen jungen Trieben entsprossen, die schon 1 Fuß Höhe erreicht hatten, an ihren Spitzen konnte man die Knoten der jungen Blütenknospen schon fühlen. Von allen Steppenpflanzen hat dieses nutzlose Kraut (es sei denn, [p.44:]dass man vielleicht aus den Samen den schönen roten Farbstoff herstellen lernt, auf dessen Produktion vor einem halben Jahrhundert Akademiker Fritsche in Petersburg viele Mühe verwendete) zu dieser Jahreszeit die intensivste, angenehm dunkelgrüne Farbe. Aber wenn später die Samenkapseln reifen und die beständigen Ostwinde den feinsten Lehmstaub, d. h. die Lössgebilde der Gegenwart, beständig über die Steppe treiben, dann wird auch das Kolorit von Peganum matt, oft sogar grau. Kein Tier rührt diese Pflanze an.
Pappeln und Weidengehölze der Flussniederungen. Während der Weiterreise lernten wir auch mehrfach die Niederungen der Kuma kennen, Ihr jüngerer, aufgeschwemmter Lehmboden sagt den charakteristischen Stauden der Steppe nicht zu. Sie ernähren in großer Gleichmäßigkeit vornehmlich Gräser und sind daher ergiebige Heuschläge. Auf ihnen wuchert an manchen Stellen eine 3 Fuß hohe Cirsium-Art, — jetzt als Spezies unerkennbar, weil zu jung, — was schon auf große Feuchtigkeit des Bodens schließen lässt. Wo diese zunimmt, sehen wir saure Wiesen, hohes Rohr- und Weidengebüsch. An den Rändern der Kanäle blühen Cynoglossum und Hyoscyamus. Dem landschaftlichen Gesamtbilde solcher Niederungen ist ein gewisser Reiz nicht abzusprechen, zumal die öde Steppe keinen Baum besitzt, der uns in den Niederungen überall entgegentritt. Freilich sind es nur die Gestalten mittelhoher Schwarz- und Silberpappeln, die wir hier samt Sturm- und Kopfweiden antreffen, ab und zu auch wohl eine Rüster (Ulmus), aber selbst dieser eintönige Wechsel in beständiger Wiederholung thut dem Auge wohl. Bei klarer Luft machen diese Baum- und Strauchkomplexe, zwischen denen überall Weingärten gelegen sind und die den Windungen des Flusses entlang laufen, einen freundlichen und kulturellen Eindruck. Sie wiederholen sich überall in gleichem Typus da in den Steppen, wo sie von fließendem Wasser, ob Fluss oder Kanal, durchschnitten und bewohnt werden. Jetzt (18. Mai) konnte man sie erst in nächster Nähe bemerken, denn der schon seit 5 Tagen anhaltende Sturm, der im Quadranten von O. nach S. beständig blies, hatte die Luft derart mit Staub gefüllt, dass jede Fernsicht unmöglich war. Wir sahen am Tage die Sonne nicht und auch das Bild des Vollmondes Nachts, wenn es stiller in der Luft geworden, erschien nur als verschwommene Scheibe. Deshalb kann ich meinen Steppenschilderungen auch nicht die oft so malerischen Wolkendekorationen hinzulügen, auf welche in den Steppen sowohl der Maler, als auch der Schriftsteller angewiesen sind, wenn sie volle Gesamtbilder geben wollen. Unwillkürlich gedenkt man in diesem lästigen, unbegrenzten Staubmeere jener lange entschwundenen Zeiten, in welchen, bei noch viel mächtigeren Agentien, im Verlaufe der Jahrtausende die Lösslehm-Formation sich bildete. Die ungeheure Masse schwebenden, feinstzerteilten Staubes senkt sich endlich in ruhiger Atmosphäre nieder und trägt nach jedesmaligem anhaltendem Sturm sehr beträchtlich zum allmählichen Verflachen der Binnenmeere und zum Wachsen der Oberfläche des Erdbodens bei.
Wir verlassen bei Wladimirowka (auch Rebrowa) den ostwärts in das kaspische Tiefland gerichteten Kumalauf. Der Fluss erreicht bekanntlich das [p. 45:] Meer nicht. In ausgedehnten Geröhren und sandigen Flächen verliert er sich zuletzt in einer Reihe von stehenden Lachen im Sumpfe und Sande. Gleiches Schicksal haben viele andere, kleinere Wasser, die zwischen dem Terek und S'ulak in der Richtung nach Osten gebettet sind. Wir wenden uns direkt nach Süden, um auf einer Strecke von reichlich 100 km durch das Land der Nogaier zu reisen und in Mosdok den Terek und seine Niederungen zu erreichen.
Distel- und Sisymbrium-Steppen. Auf dem Wege zum einsam gelegenen Atschikulak-Platze kommen nun zum ersten Male ganz reine Distelsteppen (Carduus uncinatus) in unabsehbarer Ausdehnung, abwechselnd mit den weniger umfangreichen Gebieten von zwei Sisymbrium-Arten (S.Loeselii und S. pumilum) zur Geltung. Jene ersteren, an denen einzelne frühzeitige Blütenköpfe erschlossen sind, erscheinen obenher im reinsten intensiven Rosa, die letzteren in zwei klaren, gelben Farbentönen, Sisymb. Loeselii dunkler und voller in der Farbe, fast schon hoch Chromgelb, Sisymb. pumilum mit kleineren Blüten im hellen Schwefelkolorit. Zu Füßen der 4 Fuß hohen Distel (C. uncinatus), deren stachlige Blätter und Stengel nur mit Vorsicht gefasst werden können, wallen vor dem Winde die bereits absterbenden Poa- und Bromus-Gräser im regelmäßigen Wellengange, sie sind mehr fahlgelb als grün. Lepidium Draba steht hier in reichlich 90 m (300 r. F.) Meereshöhe in voller Blüte, auf wenig elastischen Stengeln schaukeln sich ihre weißen Kronen, ohne der Windrichtung widerstandslos zu folgen. Für den Fernblick kommt in diesen Distelsteppen nichts, was niedriger blieb, zur Geltung. Wie mit einer einzigen rosafarbenen Decke belegt, im angenehmen Farbentone der Primeln (aus der Gruppe der P. farinosa) erscheint im weitesten Umkreise ein solches Gebiet, welches seinen Abschluss erst da findet, wo der größere Salzgehalt des Bodens dieser gesellschaftlichen Charakterpflanze die Existenz erschwert und bald ganz verleidet. Nichts als weiches Rosa und helles Gelb sehen wir, soweit das Auge reicht, und darüber den milchblauen Himmel in ungetrübter Klarheit. Dazu der laute, schmetternde Gesang der Kalanderlerche. Im Vordergrunde dieses eigenartigen Panoramas malt Lep. Draba große, weiße, wenig zerrissene Flecken. In den weiteren Details findet kaum ein Wechsel statt, nur die hochwachsende, am Stengel klebrige Silene viscosa taucht hoch auf, aber sie hat, obgleich als Einzelpflanze recht auffallend, gar keine Bedeutung für die allgemeine botanische Physiognomie des Distelgebietes. Nachbarlich stehen die Gruppen von Salvia sylvestris mit denen von Melandryum pratense, unweit von ihnen sieht man Silene conica und vielverästelte Trigonella orthoceras. Daran schließt sich eine Strecke mit dann verteiltem Echinospermum Lappula und Valerianella olitoria, überall durchsetzt von verblühter Poa bulbosa. An vielen Stellen hat der Boden mehr Sand als Lehm, an anderen wird er salzig. An den ersteren konnte man noch Erophila verna erkennen, dürr und gelb standen die Reste der zusammengebrochenen Stengel mit etlichen ausgestreuten Schötchen da. Aber kräftig wucherte in der Nähe dieser Zwerge Ephedra distachya- und in [p. 46:] ihrer Nachbarschaft sah man Cerastium ruderale und Ornithogalum tenuifolium. Die Ränder der Salzlachen sind um diese Zeit noch ganz kahl, die Zeit für die Salsolen, Suaeden und Chenopodien ist noch nicht gekommen, nur einmal sah ich Frankenia pulverulenta und an mehreren, weniger salzigen Stelllen Gruppen von Zygophyllum Fabaga, deren junge Triebe bei kaum 1 Fuß Höhe saftig grün belaubt waren.
An einem kleinen Bittersalzbache in offener Steppe liegt unser Reiseziel, Atschikulak. Einige wenige alte Weiden, vollbelaubt, sind die einzige Zierde des Ortes. Dem stark bittersalzigen Wasser eines größeren, angestauten Bassins wurden Ruppia spiralis und Zanichellia palustris ß. pedicellata entnommen, und wo bei gehobenem Terrain der Boden wieder salzärmer, feister und lehmiger wurde, wucherte Asperugo procumbens, und das zählebige Gonolimon tataricum hatte den Blütenschaft schon hoch hervorgetrieben. Da standen denn auch kräftige Iris pumila mit fast reifen Früchten im Grunde der Sichelblätter, umgeben von blühenden Senecio vernalis, und ebenso verhielt es sich mit Tulipa (hier Biebersteiniana), deren spitz gekrönte Kapseln schon platzten. An ähnlichen Standorten trug Colchicum laetum die reife Frucht in den zu je dreien vereint sitzenden Kapseln. An den trockensiten Stellen hat sich Euphorbia Gerardiana angesiedelt, ihr schließt sich gewöhnlich eine größere Strecke Wermutsteppe (Art. maritima) an. In der Ansiedelung selbst, die nur aus wenigen Häusern besteht, zog Lepidium. ruderale der Straße entlang seine Bahnen.
Von nun an bewegen wir uns bis Mosdok am Terek direkt nach Süden.
Die Steppe wird eben wie der Boden einer Tenne. Am geradlinigen Horizont markieren einige Tumuli nur wenig angeschwollene Konturen. Das sind entweder alte Grabhügel oder künstlich errichtete Orientationspunkte in der Steppe. Es wird um uns her immer leerer. Der Himmel ist wolkenlos, und die höher steigende Sonne wird bei Windstille lästig. Dürftige Nogaier Kibitken und elende Hütten, aus ungebrannten Lehmziegeln erbaut, stehen weithin verstreut in kleinen Gruppen in der unabsehbaren Fläche. Auf dieser Strecke Weges von circa 100 Kilometer Weite stoßen wir auf die Kontaktlinien des unaufhaltsam gegen Westen vorschreitenden Wüstenflugsandes mit der Steppe. Vom Kaspiufer im Verlaufe der Jahrtausende wandernd, erobert sich die Wüste, wenn auch nur langsam, die Steppe. Nordwärts schreitet sie bis über die Sümpfe der darin verschwundenen Kuma hinaus, und ihre westlichsten Vorposten erreichen sogar schon den oberen Kalaus.
Bis auf 25 Kilometer Entfernung von Atschikulak bleibt alles mehr oder weniger beim Alten, d. h. das Kolorit der Steppenoberfläche, welche vorwaltend Lehmboden aufweist, wechselt je nach den herrschenden gesellschaftlich lebenden Spezies. Zuerst wieder unabsehbare gelbe Sisymbrium-Bestände, in sie mischt sich nach und nach Lagoseris (Pterotheca orientalis), zuerst vereinzelt, dann mit dem Aufhören der Crucifere dichter und ausschließlicher werdend, so dass ihre Blüten eine lichtgelbe Decke in nur 1 Fuß Höhe über dem Boden ausbreiten. Aber nur bei vollem Sonnenschein erschließen sich [p. 47:] die Blumen ganz und legen die Randblüten flach aus. Auch die kleine Lagoseris bifida lebt mit ihr zusammen, und immer nur vereinzelt finden wir die winzige Veronica praecox an denselben Stellen. Sie will sorgfältig gesucht sein, weil sie so unscheinbar ist.
Flachssteppe. Nun aber beginnt der Horizont sich licht hellblau zu färben, wir nähern uns einer weiten Fläche, auf welcher Linum austriacum dominiert. Schon sieht man die ersten Gruppen von diesem wilden Flachs. Seine großen hellblauen Blumen schwanken auf 2 Fuß hohen schlanken Blütenstengeln vor dem leichten Morgenwinde. Geschlossener werden diese Gruppen, wenn auch die einzelnen Individuen nicht gar zu gedrängt stehen, und bald deckt das milde Smalteblau ihrer Kronen in 2 Fuß Höhe über dem Boden, soweit das Auge reicht, die Ebene. Auch in solchen Leinfeldern giebt es einige hochstrebende Kräuter, die aber niemals massig vorkommen und deshalb nur dem aufmerksamen Auge auffallen, das sind z. B. hier Linaria macroura und Tragopogon pratense. Auffallender, weil höher und dunkelrot, machen sich die Blumenköpfe von Jurinea mollis bemerkbar. Aber bald findet wieder Wechsel statt. Nach etlichen Kilometern Weges tritt abermals eine Distelart, Carduus hamulosus auf, nicht so dicht wie C. uncinatus und im Habitus dürftiger, nicht so gefüllt am bestachelten Stengel. Ihre Blumenköpfe sind dunkler und eben deshalb nimmt die Steppe in 3 Fuß Höhe über dem Boden eine etwas düstere rote Farbe an, die bei ihrer dünnen Verteilung nur dürftig das verdeckt, was zu Füßen der Distel heranwuchs. Da ist es vornehmlich die dunkelblau blühende Salvia sylvestris, welche häufiger wird. Im Übrigen bleiben die bereits genannten Florenelemente strichweise in mehr oder weniger zusammenhängenden Komplexen erhalten. Namentlich gilt das von Achillea pubescens, an welcher einzelne der gelben Blütenstände sich erschließen. Anchusa arvensis kommt uns nicht aus den Augen, ungleich seltener ist Alkanna orientalis. Der Eindruck, welchen Erysimum versicolor macht, ist eigentümlich. Seine weißen und gelblichen Blütenstände an den Spitzen der spirrig auseinander gehenden Verästelungen heben sich wie große Punkte vom grünen Untergrunde in 2 Fuß Höhe ab.
Wandernde Sandsteppe. Nun aber leuchten uns von Osten her die ersten gelben Dünenlehnen der nähertretenden Sandwüste entgegen. In langen Hauptwellen (Kettensand) wogt dieses erstarrte Meer von O. und SO. nach W. und NW. Von diesen - Hauptwellen, die 3—6 m (10—20 r. F.) Kammhöhe über der Ebene erreichen, entsendet die Wüste ihre vortretenden Arme in langgezogenen Zipfel- und Lappenformen gegen W. in die Steppe. Vielbuchtig und tief eingeschnitten sind sie, aber die Hauptzungen wandern in schmalen Streifen, vom Sturm getrieben, ohne Aufenthalt rastlos vorwärts. Sie haben eine Höhe von ¾ — 1 Fuß und sie verschütten mit schwerem, kalkigem Sand alles, was ihnen entgegentritt. Aus diesen hellen und lastenden Hüllen schauen die noch frischen Stengel der dauerhaften Disteln hervor. Ebenso hatten sich die verschütteten Exemplare von Onosma tinctoria noch frisch erhalten, ihr fast borstiger Haarpanzer mag sie geschützt [p. 48:] haben. Aber an Salvia sylvestris vertrockneten bereits die endständigen Blumen. Diese Arbeit der Wüste wurde in den letzten fünf Tagen vollbracht, in der Zeit nämlich jener heftigen Stürme, deren ich während der Reise oben schon erwähnte. In diesen abgetrockneten Salvia-Spitzen fand ich ein Mittel, um die Schnelligkeit der Wanderung des Sandes während der letzten fünf Tage zu bestimmen. Tiefer als 4—5 m (12—15 r. F.) vom Rande landeinwärts konnte ich sie nicht mehr finden, da war alles kahl, das war älterer und höherer Sand. Ich darf also sagen, dass während der letzten fünf Tage der Wüstenrand sich hier im Maximum um 12—15 Fuß vorwärts bewegte. Breitere Randstreifen kommen nicht so rasch vorwärts, sie bleiben hinter den eilenden Zungen zurück. Auch teilten alte Leute, die ich später auf halbem Wege nach Mosdok befragte, mir mit, dass seit ihrer Jugend, also seit etwa 50 Jahren, diese Wüste westwärts circa 200 Faden vorgeschritten sei, also im Mittel 9 m (28 r. F.) im Jahre. Ich habe anderweitig (Petermann's Mitteilungen Ergänzgsh. 117) über die erstarrten Sandwogen des Wüstenmeeres ausführlicher gesprochen, hier aber noch Einiges über die Vegetation auf ihnen zu sagen. Die alten, schon festen und etwas bewachsenen Dünen liegen vom Westrande tief landeinwärts. Man muss gegen Osten dem Meere zu 30 km vordringen, um dort die mit Tamarix bestandenen und befestigten Sandwellen anzutreffen. Die jüngsten sind absolut nackt, am ehesten siedelt sich auf ihnen Ajuga chia an, ich brachte solche Exemplare von da mit. Wo vertrocknetes Xanthium spinosum vor dem Sturm heranflog und sich mit dem verworrenen Geäste festhakte (was nur selten geschieht, weil der Sturm zu scharf fegt) und vom Sande angeschüttet wurde, da fanden seine Samen selbst hier einen dankbaren Boden. Dicht, in lebhaft grüner Farbe, bedeckten die jungen Pflänzchen im Schutze der toten, durch den Wind versetzten Mutterpflanzen den unfruchtbaren Sandgrund. Schon trieb bei ihnen über den beiden Kotyledonen das spitz dreieckige erste Blatt mit dem tiefen, stumpfen Zahneinschnitt jederseits am seitlichen Rande. Anderweitige erste Vegetationsversuche wurden nur durch Bromus mollis und Br. sterilis, sowie durch einzelne Ranken von Convolvulus arvensis angedeutet. Auch in den ausgewehten Halden, die, zwischen je zwei hohen Sandrücken gelegen, die Wellenthäler repräsentieren und welche von festeren Thonklippen gefüllt sind, giebt es keine Vegetation, wohl aber erschien ihre Oberfläche vielfach geschrammt, und zwar in parallelen, etwas erhöhten Rückenlinien; denn der Flugsand schleift und kratzt bei seiner hastigen Bewegung und lässt nur die härteren Bodenpartieen als niedrige Rippchen stehen. — Die Sonne war höher gestiegen, der Himmel allseitig klar, die Wärme flimmerte auf den hellen Sandwogen. Über sie hin huschten eilig Phrynocephalus-Echsen (Phr. caudivoivus) und Ateuchus schwärmte durch die erhitzte Luft, um das zu finden, was er zur Bergung des Eies braucht und hier im Reiche des Todes der jungen Wüste nicht findet, denn es weidet kein Vieh und es giebt keinen Mist. Jene Echsen aber folgen der wandernden Wüste getreulich bis zum äußersten Rande, vermeiden aber auf das Sorgfältigste die Steppe. [p. 49:] Auf der ferneren Strecke bis Mosdock, etwa 70 km, verändert sich das ursprüngliche Steppenbild vegetativ wenig. Nirgends erreicht es den wahren Ausdruck der südrussischen, schwarzerdigen Ebenen, nirgends wogt in weiterer Ausdehnung ein Stipafeld. Schon bei dem Platze Kurfschukui, wo der sogenannte grusinische Chutor [Chutor == Vorwerk, kleine, zeitweise bewohnte Ansiedelung.] gelegen, zeigen sich Polygonum aviculare und Triticum repens als festgetretene Wegpflanzen und Lepidium ruderale wird zum gemeinen Unkraut. Das Erdreich verbessert sich. Wilde Esparsette und Luzerne sowie Rumex Acetosa wuchern an tiefern Plätzen, stellenweise durchsteppt Taraxacum officinale die Oberfläche, anderweitig gewinnt Malva rotundifolia die Oberhand, oder es treten, meistens in Gruppen versprengt, gelbe und weißblütige Achilleen auf (Ach. millefolium, Ach. micrantha und Ach. pubescens). Sisymbrium Sophia ist da, aber nirgends so massig, dass es sich am Kolorit der Steppenoberfläche beteiligen könnte. Es wogen wieder vor dem Winde die Bromus-Bestände. Vereinzelt sieht man hier, wie auch früher sehen, die hocherhobenen, großen Wurzelblattrosetten von Onopordon, welche Riesendistel gleich dem Bilsenkraut gerne den Wegen und Ansiedelungen der Menschen folgt, denen aber beiden die jungfräuliche Steppe nicht behagt. Von ganz untergeordneter Bedeutung für das botanische Antlitz der Steppe in diesem Gebiete sind die beiden schon genannten Euphorbien. Auf weite Strecken hin wird die breitblättrige E. agraria fast zur Seltenheit und E. Gerardiana fanden wir überhaupt nur sporadisch in kleinen Gesellschaften. Auch Anthemis ruthenica malt seine weißen Blumenflecken nur wie kleine Pflaster auf den grünen Untergrund des Steppengesichtes.
Mohnsteppe. Dagegen legt nunmehr, kaum 10 km südlich von Kurtschukui, die mehr hügelige Erde ein leuchtend rotes Prachtkleid an. Viele Millionen der Blumen von Papaver arenarium nähten es so dicht und doch leicht zusammen, dass sich sein leuchtendes Krapprot unabsehbar über die Steppe ergoss. Die durchaus geradlinig geschnittene äußere Umgrenzung solcher geschlossenen Mohngebiete beweist auf das Klarste, dass hier ehemals geackert wurde und wir uns auf ziemlich alter Brache befinden. Eigensinnig behauptete die Art diesen, vielleicht nur vor zwei bis drei Jahren gelockerten Boden, überschritt weder den breiten Weg nach Westen, noch die alte Ackerfurche nach Norden, was wir da weiter in der unberührten Steppe sahen, waren von dieser Art immer nur vereinzelte Exemplare und später im festen Thon fehlte sie ganz. Von ganz besonderer Schönheit des Steppenantlitzes darf man sprechen, wenn sich einem solchen Mohnplane ein etwa gleich großer von Linum austriacum anschließt und sich für den Fernblick im hellen Smalteblau dieses Flachses die äußersten Mohnkronen als lichte Blutstropfen hervorheben. Dem kommt von allem, was wir bis jetzt in der Kuma-Terek-Ebene sahen, nichts gleich, das ist das Hochzeitskleid ihrer Flora, sie trägt es nur werige Tage, denn zart und hinfällig ist der Stoff, aus welchem die dünnen Kronenblätter beider Pflanzen gewebt wurden. [p. 50:] Das Tierleben anlangend, so ist zu bemerken, dass Nager reichlich, wenn auch nur streckenweise vorkommen. An den besseren Lokalitäten hört man beständig das Pfeifen von Spermophilus musicus Mntr., die Einfahrtslöcher von Dipus sind nicht selten und Chthonoergus talpinus wirft Haufen wie der Maulwurf auf. Schreiadler und auch Aq. imperialis stellen namentlich den Zieseln nach. Wo Kulturen vorhanden, schwebt die Kornweihe, und Saatkrähen werden den Flussläufen entlang häufiger. Feld- und Kalanderlerchen schmettern ihre Lieder und der Staar fehlt den menschlichen Ansiedelungen nicht.
Die Niederungen des Sunsha und des Terek mit Baum- und Buschbeständen. Hiermit können wir die Schilderung dieser Steppen einstweilen abschließen. Schon treten am südlichen Horizont die Sturmweiden des unbedeutenden Kurabaches (zum Terek) auf, es schwellen die lang ausgezogenen Wellengänge des Erdbodens mehr an und ihre Thalsenkungen werden immer breiter. Die Steppe wird wieder karger, wir nähern uns Mosdok und gewinnen vom hohen Rande des alten Terekthales die Aussicht auf die Niederungen des Flusses, sie sind zum Teil noch gut mit Baum und Busch bestanden.
Die Flora dieser Niederungen ist überall dieselbe und recht langweilig. Die Exkursion dorthin brachte uns gar nichts neues. Wohl aber konnte man an einem Beispiele nachweisen, wie üppig ehedem hier der Baumwuchs gewesen und wie er seit der Eroberung des Landes, während der langwierigen Kriege mit den Tschetschenzen fast vollständig vernichtet wurde. Von allen jenen herrlichen Eichen, die hier einst standen und die im Verlaufe der letzten 60 Jahre dem Beile und dem Feuer der erobernden Soldaten verfielen, hat sich, sei es durch Zufall oder vielleicht aus einer Art religiöser Pietät, nur eine in der Gegend von Mosdok erhalten. Diese Eiche steht östlich von der Stadt in circa 3 km Entfernung und trägt bei kaum mehr als 18 m Höhe eine volle, weitschattende Krone, an welcher sich ehemaliger Kopfhieb nicht erkennen lässt. Ihr Stamm ist hohl ausgebrannt, aber der Baum ist durchaus lebensfrisch, gegen NNO. hat er eine etwa 2 qm haltende Öffnung, so dass man in ihn eintreten kann. In 1 ½ m Höhe über der Erde gemessen, erwies sich der Umfang des Baumes zu 5 ½ m. Die Flora der Niederungen und Inseln des Terek ist arm. Üppiges Weidengebüsch überall, dazwischen Prunus divaricata, Evonymus europaeus, Cornus australis, der kaum von C. sanguinea verschieden ist, ferner Viburnum Opulus, Ligustrum vulgare und Corylus Avellana. Wilder Hopfen ist gewöhnliche Schlingpflanze, die Rebe nicht selten, doch hatte ihr Blatt jetzt (21. Mai) nur 1/4 der Normalgröße erreicht. Rubus caesius und Aristolochia Clematitis bilden Kolonieen, Rapistrum rugosum und Matricaria Chamomilla begnügen sich mit dem dürftigen Boden, während Ulmaria Filipendula und Melandryum auf besserem Wiesengrunde, Arabis perfoliata und Myosotis sparsiflora im Halbschatten des Gebüsches wuchsen und Carex riparia die Stillungen des Wassers einfasste.
Gemischte Steppe. Auf der 90 km weiten Strecke, welche Mosdok von Wladikawkas trennt, hat man wieder die beiden O.-W.-Gebirgszüge zu [p. 51:] passieren, von denen ich S. 26 sprach. Ihre Gipfel steigen bis über 600 m (2000 r. F.), ihre Pässe zu 480 m (1600 r. F.) an. Bis zum Fuße des ersten dieser Gebirgszüge ist die Steppenflora fast aus allen bis jetzt gesehenen charakteristischen Gewächsen gemischt. Es blinken die Silberflecken von Stipa hier und da auf, die genannten Achilleen, Sisymbrien, Lepidium und Linum austriacum sind da, ebenso Verbascum phoeniceum, und an Stelle des Mohns zeichnet hier Glaucium corniculatum ihre leuchtenden roten, aber nie sich hoch erhebenden groben Punkte in den bunten Teppich. Merklich nehmen mit der Annäherung zum Gebirge die Gramineen zu, aber es wirkt an ihnen, auch wenn sie mehrjährig, die Sonne schon vernichtend; wo solphe vorwalten, sieht man gelbliche Stellen im Grün. Von Holzgewächsen treten Rhamnus Pallasii == Rh. erythroxylon und Schlehen, Pr. spinosa als niedriges, stark bedorntes Strauchwerk am weitesten in die Ebene gegen N. vor, aber trotz eifrigen Suchens habe ich weder hier noch anderswo in den bis jetzt bereisten Gegenden Amygdalus nana, die so bezeichnend für die südrussischen Steppen ist, gefunden. Es scheint, dass die Stawropol'schen Höhen ihr die Ostgrenze ziehen, denn auch am Kalaus fehlt sie schon, während sie Normann in seiner Flora stavropolensis aufführt.
Dürftiges Buschgehölz in diesen äußersten nördlichen Vorbergen (Sunsha-Terek - Scheide) des Kaukasus. Erst wenn man sich nahe zur Kammhöhe des nördlicheren der beiden Gebirge erhoben hat, erfreut dürftiges Buschgehölz, aus welchem gegen Osten weiter hin noch einzelne alte Bäume hervorragen, das Auge. Auch hier sehen wir wieder die gewöhnlichsten Holzgewächse: Acer campestre, Quercus sessiliflora, Carpinus Betulus, Wildbirnen, Evonymus latifolius und Prunus Mahaleb. In solchen Gehölzen wuchsen von Kräutern fast nur die Arten des Waldes, so: Euphorbia amygdaloides, Polygonatum latifolium, Veronica Chamaedrys, Asperula odorata, Geranium sanguineum. An freieren Stellen waren Ajuga genevensis, Thymus Serpyllum, Centaurea axillaris (delta) cana und Iris nudicaulis = I. furcata recht häufig. Hohe Nesseln und Sambucus Ebulus stehen überall am Wege. Wo die Abhänge entblößt, siedelte sich Tussilago Farfara an, welches nunmehr das ausgewachsene Blatt hart am Boden zeigt, während seine frühen Blütenstengel schon eingingen. Am Rande des Gebüsches machten sich die hohen, lockeren Polster der feinzerschlitzten Grundblätter von Prangos oder Cachrys sp. durch ihre etwas lauchgrüne Färbung bemerkbar. Auch Hesperis - Gruppen (H. matronalis) sah man und Inula Helenium entwickelte ihre großen Grundblätter, die jetzt noch halb zusammengeklappt waren. Diese dürftigen Reste einer gewiss ehedem viel üppigeren Waldflora bilden auf der Strecke bis Wladikawkas den Glanzpunkt der botanischen Physiognomie. Von nun an kommt in den breiten Thalsenkungen vornehmlich Grassteppe, die in trockenen Jahren und so auch in diesem so kärglich ist, dass sie auf Heuschlag nicht verwertet werden kann. Es sei denn, dass einer der kräftigen Gewitterregen, welche sich meistens am Fuße des Gebirges im Frühsommer ergießen, auch die in Rede stehende breite [p. 52:] unbewohnte Thalsenkung zwischen den beiden Gebirgen noch bei Zeiten erfrischt. Auch die Passage über das zweite, südlichere Gebirge, welches durchaus waldlos ist und sehr stark beweidet wird, bot uns immer nur karge Grassteppe. Dann aber trat uns, schon deutlich erkennbar in seinen bestimmten Konturen, das Panorama der Hauptkette entgegen. Sein östlicher Teil war von dunkeln Gewitterwolken verschleiert und die Eiszone des Kasbek lag in dichte Nebel gehüllt.
Von Wladikawkas zum Terek-Delta. Der nun folgende Abschnitt behandelt die Vegetation am Nordfuße des Kaukasus von Wladikawkas gegen Osten zunächst bis Chassaf-jurt und dann gegen NO. durch die Tiefsteppen bis in das Delta des Terek. Auf der ersten dieser Strecken kommt der reine Steppentypus, wenn überhaupt, so doch immer nur in verhältnismäßig enger Umgrenzung vor. Dagegen finden wir oft ein interessantes Gemisch von typischen Steppenpflanzen mit Arten, die eigentlich dem Mittelgebirge und Walde angehören und deren Vordringen nach Norden entlang dem Fuße des Gebirges auch hier überall da stattfindet, wo die Qualität des Bodens es gestattet, d. h. wo Salz in ihm fehlt und Humus wenn auch nur in geringem Prozentsatze vorhanden ist.
Heftige und anhaltende Regengüsse, welche in der zweiten Hälfte des Mai-Monats fielen, hatten der Steppe wohlgethan. Als wir am 27. Mai von Wladikawkas aufbrachen, um ostwärts bis zum Kaspi zu wandern, prangte gegen N. auf der Strecke von circa 20 km die saftig grüne Ebene strichweise im herrlichsten Blumenflor. Wärme und Regen hatten manches gezeitigt. Schon verlieh Echium rubrum, wo es dichter in kleinen Gruppen beisammen stand, diesen die dunkle fleischrote Färbung durch seine erschlossenen Kronen und vereinzelt wuchs es ebenso wie Verbascum phoeniceum überall gleich Lichtern hoch aus dem Grün des Bodens hervor. Mächtiger und mit den vollen Blütenständen breit ausgelegt erscheinen die Gruppen von Hesperis matronalis im angenehmen Lilarosa 4 Fuß über dem Boden. In ihr lernen wir eine der größeren wandernden Waldpflanzen kennen, welche auf dem Scheider zwischen Kuban und Terek sogar bis jenseits von Stawropol vordrang. Ihr zu Füßen stehen die zarten Triebe von Veronica maxima mit lichtblauen Blumenähren, oder es leuchtet uns weiter abwärts davon in geschlossener Umrandung das schöne Lasurblau von blühender Ajuga genevensis entgegen. Was wir bei unserer ersten Exkursion nur vereinzelt sahen, ist jetzt in Menge vorhanden. So Barbarea, Ranunculus oxyspermus, Euphorbia iberica, welche die gelben Farbentöne vertreten. Mohn und Flachs in den oben genannten Spezies sieht man nur vereinzelt und die trivialen Formen von Lepidium Draba, Sisymbrium Sophia und S. Loeselii sind, wenn auch nicht ganz, von dieser nobeln, blumenreichen Grasflur ausgeschlossen. Immer nur sehe ich Salvia sylvestris, niemals hier die ihr nahestehende S. nutans, und die anderweitig so stark verbreitete S. verticillata bevorzugt als Standort den Fuß des Gebirges, nicht die Ebene. Ebenso gehören auf dieser Strecke die hohen und behaarten Salbeispezies, S. Aethiopis und S. austriaca zu den Seltenheiten. [p. 53:] Noch muss ich der Gesellschaften von Anchusa arvensis, von Polygala comosa, Centaurea axillaris (gewöhnlich, so auch von Trautvetter, als C. montana nicht geschieden, Boissier III. 636 trennt, aber fügt ein ? hinzu), dazu die zarten Gewinde der großblumigen Vicia tenuifolia erwähnen, um die Zahl der typischen Gewächse auf diesen Gründen zu vervollständigen. Blühendes Plantago lanceolata warf überall zierliche Sternchen auf das bunte reinfärbige Steppenkleid. Die seitwärts vom walzigen Blütenstande hervorragenden Antheren zeichnen diese feinen Figuren in 1 Fuß Höhe im frischen Grün.
Nun verändert die Straße die Richtung (bei Beslan), wir wenden ganz nach Osten. In den Niederungen des KambyIejew-Flüsschens bleibt vegetativ alles ebenso. Herrlich strahlt von Süden das Gesamtpanorama der Nordseite des Großen Kaukasus uns entgegen. Mehr und mehr gewinnt man die Übersicht auf die Ostfront des Kasbek, der mit seinem stumpfen, schneeweißen Kegelhaupt aus 5042 m (16546 r. F.) Höhe um sich schaut. Vor ihm die dunkeln, zerrissenen vulkanischen und Urschiefergebirge, dann die kalkigen, gelbbraunen Mittelstöcke, endlich die durchweg mit Laubholz bewaldete erste Fußkette, nach Ost und West in milderen Höhenlinien fortlaufend.
Ostwärts senken wir uns nach und nach in den breiten Thälern der Sunsha und des Terek auf einer Strecke von 230 km von 435 m (1433 r. F.) (Nasran) bis an das Westufer des Kaspi 26 m (86 r. F.) unter dem Niveau des Schwarzen Meeres. Grosny in 90 km Entfernung liegt nur 127 m (420 r. F.) über dem Meere. Unser nächstes Ziel Chassaf-jurt, in der Kumyk-Ebene am äußersten Gebirgsrande gelegen, nur noch 81 m (270 r. F.).
Auf dieser Strecke von Nasran bis Chassaf-jurt wechseln die Vegetationstypen der Steppe in größeren Entfernungen. Eine wirklich reine südrussische Steppe mit unbegrenzter Aussicht in die Ferne, mit unabsehbaren Stipa- oder Festuca-Flächen giebt es hier gar nicht. Ebenso fehlen auch die ausgedehnten Wermutgebiete. Alles das erklärt sich durch die Nähe des Gebirges, auf dessen ganz verflachtem Fuß man bei Chassaf-jurt tritt und der bei Grosny nur in geringer Entfernung gegen Süden bei dem Austritt des Argunj in die Ebene steht. Offenbar wird diese schmale Zone auch im Sommer vom Himmel durch Taufall genetzt und außerdem variieren in ihr die Bodenqualitäten vielmehr als in den auf weite Strecken hin gleichartigen Steppen. Im allgemeinen wird dieser Boden auf der höher gelegenen Steppe je weiter nach Osten um so leichter und damit die Flora dürftiger. Nur rechts von unserem Wege lachen die breiten Sunshaniederungen uns frisch entgegen. Ihr helles aber intensives Grün wird manchmal von dunkeln, wuchernden Rumex- und Cirsienstauden unterbrochen und dem vielbuchtigen Lauf des Flusses folgen auch hier getreulich Weiden und Pappeln. Auf magerer, hoher Steppe hat dagegen der Sonnenbrand schon viele Gewächse vernichtet, große hellgelbbraune Flecken kennzeichnen die Standorte der vertrockneten Frühlingsgramineen. Die Pracht der Blumen, welche wir zuletzt noch in der Niederung der Kambyiejewka sahen, ist verschwunden. Schon bei Siepzowa ist Echium rubrum nicht mehr [p. 54:] zu sehen, dagegen macht sich jetzt das verblühte Lepidium Draba durch die Trugdolden der vielen gelblichen Schötchen kenntlich; weithin herrscht Salvia sylvestris fast ausschließlich, aber ihr Kolorit ist matt, sie dürstet in diesem leichten Boden, ihre Blütenähren hängen schlaff abwärts, die Temperatur im Schatten steigt nicht selten bis auf 24° C. Schon macht sich wieder der graugrünliche Farbenton des Wermut bemerkbar, aber er eroberte sich nicht größeres Terrain. Erst auf der Strecke zwischen den beiden Hauptzuflüssen der Sunsha, nämlich zwischen Assa und Argunj, verbessert sich zusehends die Flora. Ein weites Feld, wohl an 10 km breit, der rosa blühenden Distel (Card. uncinatus) unterbricht die einförmige Salvia-Steppe, die Artemisien verschwanden ganz. Später sehen wir wieder hellgelbe Sisymbrium - Felder mit Salvia sylvestris und Euphorbia agraria, gruppenweise weißblühende Achillea darin. Elend bleibt immer nur das trockene, linkerseits von der Sunsha gelegene Gebirge, auf seinen gegen Süden gekehrten Gehängen wogen strichweise Stipa und Bromus über den vertrockneten Frühlingscruciferen.
Paliurus-Bestände. Schon bei Grosny giebt es auf den hügeligen Erhebungen zwischen Sunsha und Argunj Paliurus-Gesträuch. Östlich vom letzteren steht es überall dichter und hier tritt es an der Nordseite des Gebirges als Maquis bildend in seine Rechte. Aber diese Paliurus-Reviere sind gegenwärtig winterkahl; grau und tot hebt sich das stachlige Gesträuch 5—6 Fuß hoch auf dem Boden hervor mitten im lachenden Frühling. Sieht man genauer hin, so ergiebt sich, dass die hier heimische Pflanze in ihren oberen Teilen 2—4 Fuß abwärts frosttot ist, nicht etwa nur in den letzten Trieben, sondern auch im alten Holz bis Fingerdicke. Neues Geäst bricht von unten vor und an manchen Stellen hat das beschädigte Holz den steigenden Saft angezogen und sich leidlich erholt. Da haben wir also eines der Beispiele von den Wirkungen kontinentalen Klimas mit Minimaltemperaturen von —25°C. Andere werden wir im Verlaufe unserer Mitteilungen noch kennen lernen. Je weiter wir ostwärts bis Chassaf-jurt wandern, um so größer werden die lästigen Paliurus-Bestände. In ihrem Geäste ranken wilder Spargel, namentlich Asp. verticillatus hoch heran. Bevor man, unmittelbar nach Überschreitung des Bellajaflüsschens, in die Terek-Ebene tritt, zieht noch einmal am Argunj die hügelige Steppe, obenher von besserem Erdreich bedeckt, ein stattliches, stark modifiziertes Frühlingskleid an. Hoch ragen überall an den sanften Gehängen die doldigen Blütenstände von Valeriana officinalis hervor, 4—5 Fuß hoch überragen sie die Bodenflora, Lathyrus rotundifolius rankt im dürren Paliurus-Busch, Ulmaria Filipendula hat Maximalhöhe erreicht, auch sie schoss im Blütenschaft über 3 Fuß hoch empor, ebenso die Hesperis-Gruppen. Von eigentlicher Steppe ist hier kaum die Rede, alles ist durcheinander gemischt, Wald- und Steppenformen vertragen sich in den Paliurus-Maquis. Sogar Stipa pennata flackert in vereinzelten Büscheln zwischen den Disteln und Euphorbien, zwischen den Valerianen und Aristolochien auf, ihre nächsten Nachbarn sind Papaver hybridum und Tragopogon collinum. [p. 55:] Nunmehr tritt man bei Gudermess in die weite Terekebene, weit vor uns gegen N. und NO. dehnt sich das ebene Land, die Wärmestrahlung ist stark, die Horizontallinie undeutlich verschwommen. Der Boden, auf den wir treten, ist zum Teil sandig. Sofort treten Statice (S. Gmelini) auf und die blassen Blümchen vom spirrigen Echinospermum Lappula malen mit dünner Farbe über dem hellgrauen Boden nicht nur Kleckse und Flecken, sondern weithin ganze lichte bläuliche Schleier. An feuchteren Stellen steht dichtes, niedriges Rohr, oder es durchbrach den kahlen, gewiss etwas sandigen Boden eine Iris-Art mit schmalen, dunkeln Blättern, die schon Fußhöhe erreichten, aber noch keinen Blütenschaft getrieben hatten (Iris notha).
Bald hebt sich das Terrain rechterseits vom Wege, man fährt über die letzten niedrigen Bodenwellen, mit denen das Gebirge gegen Norden in die grenzenlose Ebene tritt. Es ist nicht nötig, die Vegetation dieser niedrigen Hügelländer in ihrer physiognomischen Bedeutung ausführlich zu beschreiben, wir haben sie im Wesentlichen schon aus dem Vorstehenden und aus den Wäldern am Podkumok kennen gelernt. Es wird genügen, das Verzeichnis der gesammelten Arten zu geben und, wo nötig, einige kurze Bemerkungen dazu zu machen. Auch hier findet man unweit der Bachläufe größere Jungbestände von Eichen (vorwaltend Qu. sessiliflora) untermischt mit einigen anderen Laubholzarten. Es ist fast alles wie am Podkumok, nur konnten wir einige der spezifischen Waldpflanzen wie Corydalis Marschalliana, Dentaria bulbifera und Con. majalis nicht entdecken, dagegen waren Viola Besseri und blühende Lonicera Caprifolium vorhanden, es gab Hopfen und Weinranken, dem Rande dieses Wäldchen entlang standen Weißdorngebüsche (Crt. monogyna).
In den schattenden Eichenwäldern von Chassaf-jurt wurden von Ende Mai bis Ende Juni 1894 gesammelt:
Cornus australis C. A. Mey.
Crataegus monogyna Jacq.
Evonymus verrucosus Scop.
Geum urbanum L.
Lithospermum purpureo-coeruleum L.
Lonicera Caprifolium L.
Melica nutans L.
Piptatherum virescens (P. de B.) Trin.
Viburnum Lantana L.
Viburnum Opulus L.
Viola canina L.
Viola Besseri Rupr
Vitis vinifera L.
Daselbst an den Waldrändern und in den Paliurus-Maquis:
Ajuga genevensis L. auch Steppe.
Allium rotundumL.Saatfelder,Wiesen.
Astragalus verticillaris L.
Carex muricata L. auch im Walde.
Centaurea orientalis L. auch Steppe.
Centaurea scabiosa L. Saat.
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. 5—6 Fuß hoch.
Crepis rigida W. K.
Crupina vulgaris Cass.
Cuscuta Epithymum L. auch Steppe.
Cynanchum acutum L. im Pal. Maquis.[p. 56:]
Delphinium divaricatum Ledb. auch Steppe.
Dictamnus fraxinella Pers.
Echinops sphaerocephalus L.
Erysimum aureum M. B. auch Steppe.
Euphorbia Esula L.
Fumaria Vaillantii Loisl. auch Steppe.
Galium verum L. massenhaft.
Galium cruciatum Sm.
Galium Aparine L. Pal. Makis.
Geranium columbinum L.
Heleocharis palustris (L.) R. Br. feucht.
Inula britannica L.
Inula germanica L. auch Steppe.
Inula Oculus Christi L.
Lathyrus sylvestris L.
Lathyrus rotundifolius Willd.
Lathyrus Aphaca L. bis 4 Fuß hoch.
Lepidium propinquum F. et M.
Lysimachia dubia Ait.
Melampyrum arvense L.
Nepeta nuda L.
Nigella arvensis L.
Onopordon Acanthium L. auch Steppe.
Papaver hybridum L. Raine.
Picris hieracioides L.
Plantago lanceolata L. massig.
Polygala comosa Schk.
Potentilla recta L.
Psephellus dealbatus (Willd.) Boiss. aufgeschwemmtes Land, vom Gebirge herunter gekommen, manchmal massig.
Ranunculus polyanthemus L.
Rubus caesius L.
Rumex crispus L.
Scabiosa ochroleuca L.
Scorzonera eriospermaMB. Schwemmland.
Senecio brachychaetus DC. 4 Fuß hoch.
Silene italica (L.) Boiss. auch Steppe.
Stachys germanica L. auch Steppe.
Thalictrum minus Jacq.
Tordylium maximum L.
Tragopogon collinum DC. auch Steppe.
Tragopogon pratense L.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium pratense L.
Valeriana officinalis L.
Veronica spicata L.
Vicia sativa L.
Vicia tenuifolia Roth.
In der Steppe:
Achillea setacea W. K.
Acroptilon picris (Pall.) DC.
Althaea hirsuta L. massig.
Anchusa arvensis (L.) M. B.
Bromus tectorum L.
Carduus acarithoides L.
Carduus nutans L.
Carduus pycnocephalus Jacq.
Carthamus lanatus L. massig.
Centaurea maculosa Lam.
Centaurea solstitialis L.
Delphinium ajacis L. wenig.
Echinospermum barbatum (M. B.) Lehm.
Eremostachys laciniata (L.) Bge.
Eryngium campestre L. geht hoch ins Gebirge.
Euphorbia Gerardiana Jacq.
Falcaria Rivini Host. Wegränder.
Festuca sp. L. hoch.
Hordeum murinum L.
Jurinea mollis (L.) Rchb.
Koeleria cristata (L.) Pers. Gruppen.
Leonurus Cardiaca L. Schuttpflanze.
Lithospermum officinale L.
Lolium perenne L. wenig.
Malcolmia contortoplicata (Steph.) Boiss.
Malva sylvestris (L.) Fr.
Marrubium peregrinum L. [p. 57:]
Onobrychis sativa Lam.
Phlomis pungens Willd.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Salvia sylvestris L.
Scabfosa micrantha Desf.
Sisymbrium Loeselii L.
Stachys iberica M. B. ß. pallidiflora Boiss
Stipa pennata L.
Wir begeben uns nun, es ist Ende Mai, zum zweiten Male in die Steppe und zwar von Chassaf-jurt in der Hauptrichtung nach NO. zum unteren Terek.
Mit dem Aksaiflüsschen, welches im tiefgefurchten, vielfach gewundenen Bette dem Terek eine Zeitlang ziemlich parallel läuft, schließt die mit Paliurus-Maquis bestandene Hügelsteppe ab. Nur den hochaufgeschütteten, seitlichen Wänden der Bewässerungskanäle folgen in dem lockeren und feuchten Boden immer noch die Stauden und einige Gebüsche des äußersten Gebirgsfußes, so Schlehen und Wildrosen, Sambucus Ebulus, Rubus caesius und Rhamnus Pallasii, dann auch hohe Thalictren und Card. acanthoides, dann wieder Galium verum und Silene italica.
Der Burian. Die Frühlingsperiode ist beendet, es beginnen sich jetzt die dauerhafteren Pflanzenarten des Sommers, die hochschießenden Stauden, welche zum Teil später abgetrocknet den »Burian« bilden, zu entwickeln. Vor allen macht sich Centaurea solstitialis, schon spirrig bis zu 2 Fuß Höhe verästelt, durch ihre endständigen gelbglänzenden Stachelsterne sehr bemerkbar.
Sie behauptet anmaßend ihre Standorte, oft in ganz reinen Beständen, und erreicht über Meterhöhe. Auf weite Strecken hin nimmt in engem Verbande, jetzt erst ¾ Fuß hoch, Acroptilon picris seine Reviere ein, es folgt gerne den Wegen und fällt durch das helle Graugrün der lanzettlichen Blätter auf. An den Spitzen erkennt man schon die dicken ovalen und nach oben hin zugespitzten Blütenknospen. Ebenso gesellschaftlich verhält sich Xeranthemum annuum. Auch der gemeine Wermut und Beifuß (Art. Absynthium und Art. vulgaris) bisweilen sogar gemischt, begleiten uns beiderseits vom Wege, solange es noch ab und zu niedriges Gebüsch giebt, und dazwischen bedeckt Delphinium Ajacis kleinere Reviere, die durch seine Blumen intensiv violett gefärbt werden. Eryngium campestre formt seine niedrigen Kugelgestalten aus, gelbgrau in der Farbe stehen sie steif da. Ab und zu heben sich, höher als die anderen Gewächse, die filzig behaarten, massiven, breit im Geäste ausgelegten, stumpf konisch gebauten Exemplare von Salvia Aethiopis, sie stehen in voller Blüte. Nirgends aber sehe ich hier Xanthium speciosum, dagegen bedroht der stachlige Carthamus lanatus die Wegränder und nimmt gegen Osten immer mehr an Häufigkeit zu. Man fährt oft auf rasenartiger Unterlage von Polygonum aviculare und es werden die in der Frühsonne erschlossenen Blumen von Convolvulus arvensis hart am Boden liegend gleich großen rosafarbenen Punkten gesehen. Auch die tiefgehende Quecke durchzieht das Erdreich mit ihren Ausläufern, während das niedrige Hordeum murinum der Hitze erlag.
[p.58:] Tamarix-Gebüsch und Iris-Steppe. Bald ändert sich diese Physiognomie. Die Steppe wird tennenglatt, ihr Erdreich leichter, oft mit sandigem Untergrund. Man sieht kahle, hellere Bodenstellen, ein leichter Salzgehalt mag ihnen zukommen; wo er fehlt, sind vertiefte Löcher ausgeweht. Auf erhöhtem Boden begrüßen wir die ersten Tamarix-Gebüsche (T. Pallasii) jetzt in voller Blüte, vor uns dehnt sich ein weites Gebiet, in welchem fast nur ausschließlich zwischen spärlichem Hordeum murinum die 1 Fuß hohen Iris-Gruppen (I. notha) stehen, je nach dem Alter ihrer harten, lebenszähen Wurzelstöcke von 1—4 Fuß Durchmesser. Sie zeichnen dunkelgrüne Flecken in die helle gelbe Grassteppe und haben nunmehr die ersten wässrig hellblauen Kronen erschlossen, an denen die Basis der Petala hellgelb gefärbt ist.
Alluvialflora des Terek. Wir nähern uns dem flachen und breiten Terekthale, an welchem entlang unmittelbar am linken Ufer sich Baumwuchs und Gartenland hinziehen. Ein faschinierter Damm hält den Strom linkerseits im Zaume. Der Spiegel des trüben Lehmwassers, welches in flachen Strudeln rasch dahinflutet, liegt an manchen Stellen kaum einen Fuß tiefer, als diese künstliche Uferhöhe. Die Niederungen zwischen Damm und Fluss sind dicht mit Weiden, Salix alba und Schwarzpappeln, auch mit Morus alba bestanden, dazwischen sieht man silbergraues Elaeagnus-Gebüsch, E. hortensis, am Bö den überall Rubus caesius und Chelidonium majus. Von Kräutern auf Schwemmboden fand ich nur recht gemeine Arten, so z. B. Ran. repens, Euphorbia Esula, Vicia villosa, Potentilla supina, Potentilla reptans und Carex praecox. Dem gegenüber hat die Ebene rechts vom durchsickernden Flusswasser Sumpfcharakter angenommen. Überall ausgedehnte Rohrbestände, überall verwetterte Typhakolben vom vorigen Jahr, überall dunkle Binsengruppen, deren endständige Blütenhaufen solchen Plätzen eine kastanienbraune Decke auf fast schwarzgrüner, hoher Unterlage verleihen. Ich glaube nicht, dass in diesen ungangbaren Sumpflabyrinthen der Botaniker neue Formen entdecken wird. Bis auf die Üppigkeit des Wuchses sieht das alles ganz nordisch aus. Scirpus maritimus, S. lacustris sowie Typha dominieren, die oft ganz reinen Rohrbestände, von Phragmites gebildet, erreichen bis 10 Fuß Höhe, verwehte und verblichene Blütenähren vom vorigen Jahre erhielten sich. Auch Butomus und Iris Pseudacorus fehlen nicht und beginnen zu blühen. Von den Sauergräsern waren Carex muricata und C. distans am häufigsten. Auf den zusammengebrochenen Binsen haben sich Gruppen von Emys lutaria im hellen Sonnenschein niedergelassen.
Man bleibt am linken Terekufer, wenn außerhalb des Kulturlandes, entweder in der Irissteppe oder in der licht bebuschten, etwas hügeligen Ebene. Hier giebt es viel Tamarix, Crataegus, Prunus spinosa, Rhamnus PalLasii, Cornus sanguinea, ab und zu auch Wildbirnen. Es flogen bereits die Pappus von Tragopogon, von Carduus pycnocephalus und C. uncinatus vor dem Winde. Ab und zu tritt Zygophyllum Fabago auf und überrascht wird man durch Dodartia orientalis; Glycyrrhiza glabra wird häufiger. Weder Alhagi noch Peganum werden bis jetzt gesehen und Xanthium spinosum bleibt auf die [p.59:] Ansiedelungen als Schutt- und Mistpflanze und auf Aschenhaufen angewiesen. Dagegen nimmt an manchen Stellen auf offener, hügeliger und teilweise bebuschter Steppe Asparagus officinalis an Häufigkeit so zu, dass man fast von einer wilden Spargelsteppe sprechen könnte. Das helle Grün des feinen Spargellaubes wirft zarte Decken über den sandigen Boden, welchem abwechselnd auch Xeranthemum annuum nicht fehlt. An solchen Stellen wirft der Sandmoll seine Hügel auf, die bei fast 1 m Durchmesser sich bis 2 Fuß Höhe erheben.
Steppenflora im Terek-Delta. Bei dem weiteren Verfolge der Straße, immer gegen NO. bis in das geräumige Delta des Terek, wechselt die Physiognomie der Pflanzenwelt wiederum sehr wesentlich. Zunächst verschwindet Salvia sylvestris fast ganz, wogegen Glycyrrhiza an Masse zunimmt und oft von Dodartia durchsetzt wird. Diese ist dicht gruppiert, fußhoch mit gerade aufstrebendem Geäste, an welchem das reduzierte Blattwerk sich so wenig bemerkbar macht, dass die Dodartien gleich nackten Besen dastehen, die jetzt zu blühen beginnen. Wo das Terrain sich hebt, steht in großen Gesellschaften Carthamus lanatus spirrig, steif, stachlig, unantastbar. Onopordon liebt die Nähe der Dörfer und besiedelt die Kerichthaufen, seine Köpfe sind noch geschlossen, die ganze Pflanze ist mehr hellgrau als grün koloriert. Auch kommt hier wieder Achillea pubescens vor, sie verdrängt nach und nach die weißblühende Achillea setacea. Diese wird seltener, jene häufiger. Unverändert bleibt die geringe Zahl der Gebüscharten. Elaeagnus wird häufiger, Eichen sind selten, Cornus sanguinea, Schlehen und Rhamnus Pallasii halten am längsten aus. Von Paliurus nirgends eine Spur. Als Wegpflanze tritt Atriplex laciniata mit Polygonum aviculare in den Kampf. Zygophyllum-Stauden überall und auch das Bilsenkraut folgt vereinzelt der großen Straße. In Sophora alopecuroides tritt uns ein neues Element, welches bis dahin nicht gesehen wurde, entgegen. Es beengt die Süßholzbestände, wird gegen Osten häufiger und beginnt jetzt zu blühen. Bescheidener verhalten sich Alhagi und Peganum, beide wurden zum erstenmale 12 km SW. von Kisljar im Sande gesehen. Je mehr man sich diesem Orte nähert, um so häufiger wird auf trockenem Boden Elaeagnus hortensis; an solchen Stellen steht es als 12—15 Fuß hohes, dichtes Gebüsch ganz ausschließlich. Noch muss erwähnt werden, dass die verwilderte Rebe an manchen Bäumen, so auch an den ebenfalls verwilderten Maulbeeren hochrankt, aber nie kräftig wird, wohl in der Wurzel frostfest ist, aber leicht im schlecht verholzten Hochtriebe leidet. Sie erträgt Minimalkälten von —25° C, bei welchen die kultivierte, wenn ungedeckt, unter jeder Bedingung zu Grunde geht. Diese wird im Terek-Thale eifrigst angebaut, aber im Winter mit Erde bedeckt. Auch die Feige hält als Hochstrauch von 8—10 Fuß ohne Deckung aus.
Abschweifung in das Flachland zwischen der Wolga und den Jergeni-Höhen. Hier im Delta des Terek unterbreche ich meine Schilderungen, um gegen Norden einen Blick in das Mündungsland des größten Stromes Europas, der Wolga, zu werfen und ihn westwärts durch das Land [p.60:] der Kalmyken bis zum Manytsch schweifen zu lassen, um die Floren dieses Gebietes kennen zu lernen. Professor Krasnow (Charkow) hat im Jahre 1885 dorthin eine Reise gemacht und es in geo-botanischer Hinsicht untersucht. Er berührte dabei besonders denjenigen Teil, welcher am rechten Ufer der unteren Wolga sich südwärts über den Manytsch zur Kuma erstreckt. Dabei wurde ebensowohl der Stromlauf abwärts von Sarepta, sein Delta und das Kaspiufer verfolgt, als auch landeinwärts die Steppe bis über die Jergeni-Höhen hinaus mehrfach durchkreuzt. Diese Gegenden sah ich nie. Nur einmal, im Hochsommer 1862 (Expedition v. Baer), bin ich, vom Don kommend, im unteren Teile des westlichen Manytsch aufwärts gereist. Da sich das Reisegebiet Krasnow's in seinem südlichen Teile direkt an die nördlichen Steppen des östlichen Kaukasus schließt, so benutze ich seine Arbeit und verwerte daraus im Auszuge folgendes.
Auch diese Ebenen zerfallen nach ihrer geologischen Formation in zwei Teile, in das westliche, hügelige, von Einrissen vielfach durchschnittene Löss-gebiet, welches unter dem allgemeinen Namen Jergeni bekannt ist, und das östliche, niedrige und ebene mit mächtiger aralo-kaspischer Ablagerung. Etwas westlich vom 45. Meridian von Greenw. verlaufen die Jergeni-Hügel direkt in südlicher Richtung und schwingen unter der 46. Breite nahe vor der Bifurkation des Manytsch aus. In botanischer Hinsicht weist der östliche Teil mancherlei Varianten auf, so dass man mit Recht von den Unterabteilungen einer Küstenflora, einer inneren Steppenflora und einer Vegetation zwischen Manytsch und Kuma sprechen darf.
Schwemmwiesen zwischen Wolga-Delta und Terek-Delta. Die Küstenflora zieht sich als schmaler Streifen dem Wolgaufer entlang (von Jenotajefskaja) und nimmt die ganze Strecke zwischen den Delten der Wolga und Kuma bis zum Terek ein. Durch Schwemmwiesen und durch die von W. nach O. gestreckten, parallellaufenden, niedrigen Hügelketten (Bugri) wird diese Gegend gekennzeichnet. Gegen SW. von Astrachan entwickeln sich die Bugri am stärksten und schließen zwischen sich Labyrinthe abgerundleter und langausgezogener Wasserbassins (meistens von geringem Umfange), sogenannter Urnen, ein. Durch sie drängt sich ein Teil des Wassers vom westlichen Stromesarm von N. nach S. Gegen NW. und S. werden die Bugri niedriger und die Urnen flacher, bis beide in salziger Ebene verschwinden iund, wo die Ilmenreste blieben, diese salziges Wasser enthalten. Die Flora der Schwemmwiesen, die also zeitweise unter Wasser steht, hat auch in der oberen Hälfte des Wolgadeltas noch den Charakter der Wiesen Mittel- und zum Teil Nordrusslands. Dagegen besitzt die Flora der unteren Hälfte des Wolgadeltas einen anderen, mehr südlichen Charakter. Durch Trapa natans, Vallismeria spiralis, Nelumbium speciosum und Salvinia natans, die weiter oben dem Strome fehlen, kommt diese Eigentümlichkeit zum Ausdruck, von ihnen ist Nelumbium eine tropische Art. Auch die Landflora dieses südlichen Deltateiles weicht von derjenigen der Deltawurzel wesentlich ab. Die letztere besitzt mehr den Charakter des höheren Stromteiles z. B. bei Sarepta. Oft bedeckt sehr dichtes [p.61:] Weidengebüsch (S. alba), aus welchem höhere Bäume derselben Art und Rüstern hervorragen, große Strecken. Dagegen herrschen unabsehbare Rohrbestände in der vorderen Hälfte des Deltas, jede Spur von Holzgewächsen fehlt. Durch das alljährliche Austreten der Wolga im Frühjahr werden Ufer-und Ilmenränder unter Wasser gesetzt und ihnen Sedimente zugeführt, die im Vereine mit den verfaulten Resten der Vegetation solchen Stellen Humus liefern. Die Ränder der Süßwasser-Ilmen zeichnen sich durch dunkle Bodenfarbe und durch eine lebhaft grüne Vegetationsnarbe aus. Aus dem Verzeichnisse der Pflanzen, welche Professor krasnow in diesem Gebiete sammelte (174 Sp.), will ich folgende hervorheben:

[p.62:] Halophytenflora. Von den Süßwasser-Ilmen, welche zeitweise mit dem austretenden Strom kommunizieren, bis zum salzausscheidenden abgeschlossenen See giebt es westwärts von der Wolga im Innern der Steppe alle möglichen Abstufungen in Boden und Flora. Die Schwemmpflanzen an den Rändern der Süßwasser-Ilmen verschwinden, an ihre Stelle treten Halophyten. Unter diesen sind folgende zu nennen, welche den höchsten Salzgehalt des Bodens (bis zum Auskrystallisieren) ertragen:
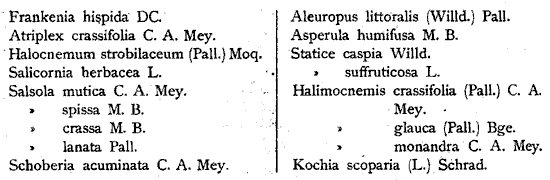
Alle diese Arten entwickeln sich erst gegen Ende des Sommers in den Hauptfarben von grau, rotbraun und matt blaugrün, zur Blütezeit von Statice und Frankenia mit lila Farbentönen untermischt. Außer den oben genannten, die das Maximum von Salz ertragen, nenne ich folgende, von denen die meisten an den. salzigen Jergenihügeln, also an der westlichen Grenze der Flachsteppen gesammelt wurden, diese bezeichne ich mit einem *.
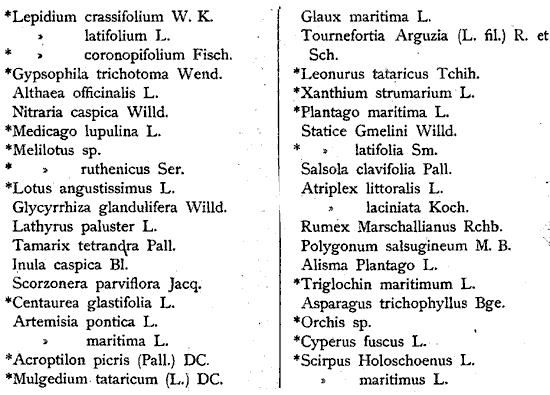
[p.63:]
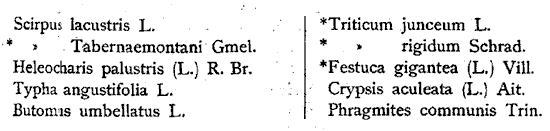
Typische Wermutsteppe. An diese Salzsteppen schließen sich die des Wermut. Ihr Typus findet sich auch in geringem Umfange auf den Höhen solcher Wolgainseln und Bugri, welche selbst der höchste Wasserstand nie erreicht, die deshalb nicht ausgesüßt sind. Gleich schwach gewölbten Glatzen heben sie sich von der umgebenden grünen Basis ab. Niedrig wachsende aralo-kaspische Pflanzenarten sind es, die wir da finden. Die Wermutsteppe ist hier wie überall im Grundton des allgemeinen Kolorits grau. Bis auf zwei Faden tiefgehende Wurzeln von Artemisia maritima und A. frigida sichern diesen dauerhaften Gewächsen die Existenz auch dann, wenn weit umher die sengenden Sonnenstrahlen fast alles andere töteten. Die Aufeinanderfolge in der Entwickelung der verschiedenen Pflanzenarten ist rasch, ihre Dauer kurz. Was einjährig ist, vollendet sehr bald den Kreislauf vom keimenden Samen bis zur Frucht, stirbt ab, verdorrt, verschwindet spurlos, weil wie im Ofen gedörrt. Die Zwiebelgewächse ruhen nach kurzer, oberirdischer Frühlingsexistenz reichlich zehn Monate im Schoße der Erde. Nirgends bildet sich zusammenhängende Pflanzennarbe. Die Vegetation beginnt ganz so wie auf der Schwarzerdesteppe mit zarten Liliaceen, Cruciferen, Ranunkeln und Mohnarten, von den Gräsern ist Poa bulbosa vivipara die vorherrschende, dann folgt die Zeit von Achillea Gerberi und von den harten Gräsern. Hitze und Trockenheit nehmen zu. Alhagi Camelorum, Xanthium spinosum, Ceratocarpus arenarius, Eryngium campestre entwickeln sich. Endlich, wenn der Sommer zu Ende geht, kommt die Zeit für die Artemisien und Halophyten. Das Gebiet solcher Steppen erstreckt sich vom Meeresufer bis in die Jergenihügel. In ihm spielt Camphorosma ruthenicum eine wichtige Rolle, insofern sie den Anschluss der Uferflora süßer und brakiger Bassins und auch der echten Halophyten zur Wermutsteppe vermittelt. Ein direkter Anschluss jener zu dieser findet nicht statt. Anknüpfend an diese Erscheinung erklärt Professor KRASNOW das im Verlaufe der Zeit stattfindende Auslaugen und Austrocknen der aralo-kaspischen Tiefländer aus der Aufeinanderfolge gewisser Pflanzenformen. Er schreibt (pag. 16): »Wie auch immer der Charakter der Uferflora eines Süßwasser-Ilmen, oder eines austrocknenden sein mag, fast nie konnte ich einen direkten Übergang von ihr in die Wermutsteppe erkennen. Das verbindende Glied war dabei immer die Camphorosma-Formation. Diese, so auffallend durch ihr Kolorit gegen den grauen Steppenboden, stets die Vertiefungen umrandend, in denen Seen, Lachen oder Salzgründe gelegen sind, regen die Idee an, dass die Vegetationstypen der Triticum-Arten, der Halophyten, Camphorosmen und Wermute den vier Epochen der beständigen Auslaugung und Austrocknung [p.64:] des aralo-kaspischen Tieflandes entsprechen.« Nach und nach nimmt die Randflora der Süßwasserseen einen Charakter an, der auf wachsenden Salzgehalt deutet. Bei zeitweiser großer Dürre gehen die Süßwasserformen zu Grunde. Nach und nach besiedelt sich die salzige Öde mit Halophyten, ihre Ränder werden im Verlaufe der Jahrhunderte wieder mehr und mehr ausgelaugt, es erscheinen an ihnen die Camphorosmen und im noch weiteren Verlaufe jener Aktion endlich die Artemisien. In diesem Stadium befindet sich gegenwärtig das kaspische Tiefland. Schwarzerde befindet sich auf den Sedimenten des Kaspi, wie Barbot de Morny schon nachwies, nirgends.
Ich lasse nun die Namen aller in dem bezeichneten Gebiete von Professor krasnow gesammelten Arten folgen und bezeichne die in der Nähe des Meeresufers gefundenen mit einem *, die nur im Hügellande Jergeni vorkommenden mit einem +
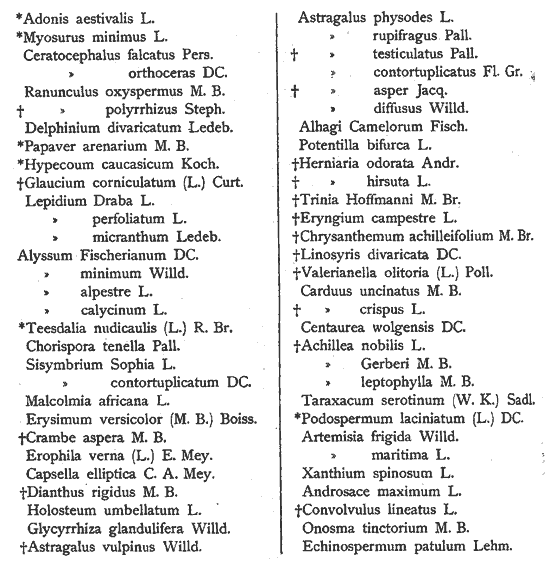
[p.65:]
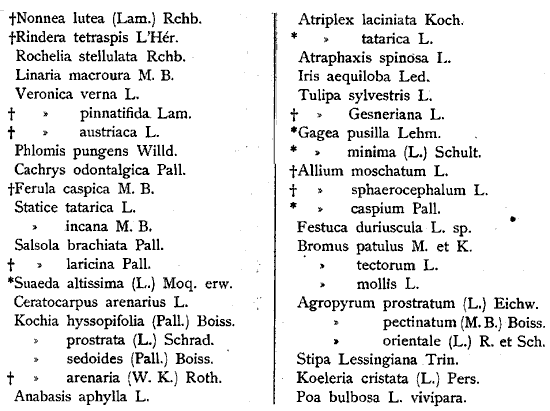
Flora der Sandbarchanen. Es folgen nun in den weiteren Erörterungen die alten Sandhügel (Barchani) und der wandernde Sand.
Sie nehmen ein großes Areal nahe vom rechten Wolgaufer gegen W. ein (Adryk) und beginnen schon nicht weit von Astrachan. Langsam erobert dfer wandernde Sand die Wermutsteppe, auf ihm wächst fürs erste nichts und was ihm in den Weg kommt verschüttet er, nicht allein die dürftige Flora, sondern auch die Vertiefungen und Urnen füllt er im Verlaufe der Zeit aus. Auch die Ansiedelung des Menschen wird von ihm bedroht, über kurz oder lang muss die Bevölkerung vor ihm weichen. Auf den alten Sandbarchanen bildet sich nach und nach eine eigene, spärliche Flora aus. Zum größten Teil siedelten sich auf ihnen Arten vom Sande der westlichen Jergenihügel an, aber auch von Osten wanderten einige kaspische Spezies ein. Es werden 63 Arten genannt. Die ersteren bezeichne ich mit einem *, die letzteren mit einem f.

[p.66:]

Soviel über die Flachsteppen im westlichen Gebiete der unteren Wolga. Ich habe nun noch über die Jergenihöhen zu berichten.
Die Flora der Jergenihöhen Die westliche Hälfte der Kalmykensteppe ist geologisch sowohl, als auch in Hinsicht auf ihre jetzige Bodenbeschaffenheit ganz anders gebildet, als die besprochene östliche Hälfte. In antiklinaler Faltung senken sich die Jergenihöhen gegen W. viel sanfter als gegen O., dort nur wenige Abflüsse zum Don entsendend, hier viel schroffer und steil einfallend in die aralo-kaspische Tiefsteppe. Hier erinnert ihr schroffes Einfallen in die Wiesengründe des Systemes der Sarpaseen an die Verhältnisse des rechten Wolgaufers oberhalb von Sarepta. Unwillkürlich wird man daran gemahnt, dass diese östliche Front der Jergenihöhen das einstige rechte Ufer des Riesenstromes war, um so mehr, als sie von der Kniebeugung der Wolga bei Sarepta (gegen SO.) sich im meridionalen Verlaufe zum Manytisch hin nach und nach auflösen, also die Richtung des Hauptstromthales oberhalb Sareptas einhalten. Die Seensysteme entlang diesem östlichen Steileinsturze der Jergeni-Höhen repräsentieren nur die mehr und mehr austrocknenden Reste des ehemaligen Wolgalaufes. Die nach O. abfließenden Wasser haben enge Schluchtenthäler eingerissen, sie sind alle nach einem Typus geformt und haben die geologischen Profile klar gelegt. Obenher lagert eine dicke Lösschicht, unter ihr Sandstein und Sand, die ihrerseits auf schwerem, gypshaltigem Lehm ruhen. Auf den Contactflächen von Lehm und Sand [p.67:] entspringen vielfach Süßwasserquellen, deren Wasser der Tiefe in der Schlucht zur Hauptader zueilt. Im Frühjahr sind diese Bäche sehr wasserreich, im Sommer bleiben meistens nur Tümpel mit salzigem Wasser zurück. Diese Bäche bilden vor ihrer Mündung kleine Deltas mit alluvialem Sande, an welchen seitwärts sich zunächst die aralo-kaspischen Bildungen und höher an diese der erwähnte Löss in Terrassen anschließen. Von diesen drei Bodenarten hängt der Charakter ihrer Flora ab. Auf dem grauen Tertiärlehm erscheint der Camphorosmatypus, auf dem kaspischen Boden der des Wermuts, auf dem alten groben Sand haben wir ein Gemisch von Pflanzen des jetzigen westlichen Kaspiufers und von solchen Arten, welche von W. einwanderten, die dem Kaspi nicht angehören, und diese letzteren gewinnen die Oberhand, so z. B. Thymus Serpyllum odoratissimus, Astragalus virgatus, verschiedene Jurineen und Potentillen. Auf den Alluvionen in der Thalsohle wechselt die Flora von oben nach unten, sie ist der Steppe gegenüber reich, hat oben den Charakter der mitteleuropäischen Vegetation ähnlicher Lokalitäten, unten den der Steppen. Auf den Lössflächen endlich tritt der Wermut zurück, dagegen gewinnen Stipa Lessingiana und Festuca ovina var. duriuscula die Herrschaft und bedingen die botanische Physiognomie solcher Plätze. Endlich ist noch der Schwarzerde und ihrer Pflanzen zu gedenken. Sie befindet sich an hren Bildungsstätten, nämlich nur auf den Lösshöhen der Jergenihügel, und von da übertragen auch auf den Thalhöhen der Wasserscheide zwischen Don und Kaspi, sie besitzt da einen Humusgehalt von 3 %. In den Vertiefungen des Bodens wächst dieser bis auf 5 % und an solchen Stellen ist auch die Erde bedeutend dunkler gefärbt. Der Wermut verschwindet von ihr vollständig, Festuca ovina löst ihn ab und herrscht, an die Stelle von Stipa Lessingiana treten St. pennata und St. capillata. Diese Steppe nimmt im Hochsommer eine fahlgelbe Farbe an, die ausdauernden harten Gräser trocknen wohl ab, aber sie brechen nicht zusammen. Die Zahl der von Prof. Krassnow für diese schwarzerdige Steppe aufgeführten Species beläuft sich auf 152, ich will von ihnen die wesentlichen nennen und beginne mit den Holzgewächsen, welche sich auf den Höhen der Thäler finden.
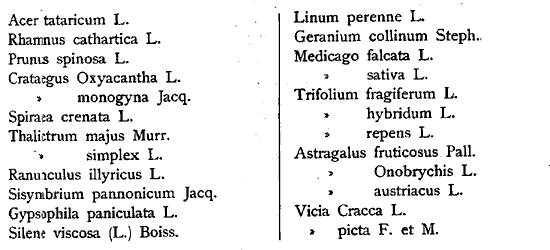
[p.68:]

In der geschilderten Weise ist das Florengebiet westlich vom Delta der Wolga bis über die Jergeni-Wasserscheide hinaus und südlich bis zum östlichen Manytsch beschaffen. Wir haben da also: Süßwasserflora, Schwemmwiesen, Wermutsteppen, Salz- und Sandsteppen und endlich die Schwarzerde. Der Anschluss dieses Gebietes an das der Kuma südlich vom Manytsch wird durch die Wermutsteppe vermittelt. Der Manytsch selbst und auch der untere Kaiaus repräsentieren den typischen Salzboden und sind im Sommer [p.69:] gewöhnlich trocken. Gleich auf den Höhen des rechten Kalaus-Ufers beginnt die Wermutsteppe. In den Einrissen wiederholen sich die Formen gleicher Lokalitäten der Jergenihöhen. Weiter südlich entwickelt sich nach und nach eine schwache Schwarzerde, welche Stipasteppe ernährt. In der Nähe des linken Buiwola-Ufers ist diese stark angebaut (Blagodatnoje), so dass dort nur fleckenweise die unberührte Steppe erhalten blieb. Der vegetative Gesamteindruck dieser Gegend entspricht der gegebenen Schilderung, die Flora ist etwas ärmer als die der Jergenihöhen, etwas reicher als die der Steppe. Die dort durchbrechenden Mactrakalke ernähren nur wenige andere Arten, wie z. B. Erysimum Orientale, Dianthus capitatus, D. pseudarmeria, Gypsophila capitata. Wenig weiter südlich erfreuen nach langer Zeit die Niederungen der Kuma durch das frische Grün ihrer Weingärten das ermüdete Auge.
Steppe zwischen Kisljar und dem S'ulak. Nach dieser weitgehenden Abschweifung kehren wir in das Delta des Terek zurück und brechen von ihm gegen Süden auf. Die Entfernung von Kisljar zum S'ulak mag mit 70 km geschätzt werden. Diese Ebene besitzt überall den Steppencharakter in den verschiedenen Kombinationen einzelner spezifischer Pflanzenarten, aber nicht den eigentlich einheitlichen der pontischen Steppen, nirgends sieht man unbegrenzte Stipa- und Festucaflächen. die Arten kommen, werden häufiger, verschwinden und werden durch andere ersetzt. Im allgemeinen aber ist botanisch diese Gegend ärmer und individuell schwächlicher ausgestattet, als die bis dahin gesehenen westlicheren Ebenen. Bisweilen darf man hier von Hungersteppen sprechen, namentlich auf den ärmsten Artemesien-Strecken.
Das Terrain ist fast überall ganz eben, oft tennenglatt, nur die hochgehobenen Bewässerungskanäle verdecken manchmal den fernen Gesichtskreis, der, immer geradlinig, nur durch die Weidengebüsche bei den Ansiedelungen mit dunkeln Strichen unterbrochen wird. Es sind Flachsteppen, kaum 30 m (100 r. F.), meistens weniger über dem Kaspi gelegen, in deren ganz wenig geneigten und breiten Einsenkungen zwei daghestaniscbe Gebirgsbäche in einer Reihe von seenartigen Lachen und Sümpfen ihre blinden Enden finden. Diese beiden Bäche heißen Aksai und Aktasch.
Je nach den vorwaltenden Spezies können wir auf dieser Strecke Weges folgende botanisch - physiognomische Kombinationen aufzählen. Von Kisljar direkt, südlich bis Katschalai, 15 km, licht verteiltes Zwergrohr, jetzt auf trockenem Boden, schwächlich, 2—3 Fuß hoch. Solche Strecken werden gelegentlich überschwemmt, aber hier ist dies schon seit Jahren nicht geschehen. Deshalb blieben auch die Weiden, welche in diesem lichten Rohr wachsen, so niedrig, sie erreichen selten mehr als 2 Fuß Höhe. Ab und zu giebt es zwischen ihnen noch ein Elaeagnus- und Tamarix-Gebüsch, Die Grundblätter von Statice Gmelini durchsteppen spärlich den graulehmigen Boden, man bemerkt einzelne Exemplare von Card. uncinatus, aber auch diese Distel bleibt klein. Glycyrrhiza wird um so häufiger, als das Rohr seltener und kümmerlicher wird. Triticum repens bedeckt die holperige Fahrstraße. Überall abgetrocknetes Lepidium perfoliatum und große gelbgraue Flecken verdorrter [p.70:] Frühlingsgramineen, darunter auch Phleum asperum und sogar Festuca ovina. Strichweise wechseln Polygonum aviculare mit Atriplex laciniata auf dem Wege ab, letzterer ganz dicht gestellt, oft nur 3—4 Zoll hoch. Alhagi camelorum zeigt sich, bald durchsetzt es die Süßholzbestände, bald das immer lichter werdende Zwergrohr, stellenweise will es allein herrschen.
Auch weiterhin von Katschalai zum versiegenden Aksai kombinieren sich die Elemente der Flora in ähnlicher, aber reichhaltigerer Weise. Wir sehen wieder weite Felder von Card. uncinatus, deren Köpfe jetzt alle weiß, weil abgeblüht und Pappus tragend sind. Dann kämpft Acroptilon picris um die Herrschaft und gewinnt sie sicherlich nach und nach, denn es verschwindet um ihn her alles andere, seine Gruppen stehen mitten in den vertrockneten und schon vom Winde zusammengebrochenen Sisymbrium- und Gramineenfeldern. Jetzt folgt ein weites Gebiet von Wermut (immer Art. maritima). Im Centralteile ganz rein, Flachhöcker neben Flachhöcker, stets von einander getrennt, nichts zwischen ihnen. In die Ränder solcher Wermutsteppen drängen sich Statice und Acroptilon, man sieht auch die hellen Triebe von Salsola Soda und S. spissa, sie sind jung, ein paar Zoll hoch, ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Auch Phlomis pungens wird bemerkt, aber die Dürre lässt ihn nicht zur Blüte kommen, er trocknet vor der Zeit ab. Nun folgt wieder eine andere Kombination, Capparis spinosa tritt auf. Die langen Triebe liegen um das Centrum der Pflanze (Halbstrauch) herum am Boden und die großen weißen Blumen sind die schönsten der Steppe in jetziger Jahreszeit. Immer erscheint Capparis nur als Einzelpflanze, zwar nachbarlich, aber doch getrennt. Dann aber erscheint ein Riese unter den Pflanzen dieser Steppen. Das ist Crambe orientalis; gesichert durch den ausdauernden Wurzelstock, schießen schon im ersten Frühjahr an ihm die kräftigen, rauhen, oft fußlangen Blätter hervor, sie sind tief ausgeschnitten und spitzlappig. Dann kommt der üppige Blütenstand, welcher über 2 ½ Fuß Höhe erreicht und auf starkem Astgestelle sich in mehr oder weniger, äußerlich regelmäßiger Kugelform auslegt, an ihr die Fülle der endständigen weißen Blumen, oder nach deren kurzer Dauer die blasigen, hochgelben Schoten. Auch Crambe darf nur als auffallende Einzelpflanze betrachtet werden. Ihr zu Füßen steht vertrocknete Althaea hirsuta, unweit davon die feinzerschlissenen, locker gebauten Wurzelblätter von Prangos sp.?, ohne zu blühen, schon im Absterben begriffen. Sonstige Vertreter der Umbelliferen werden durch Trinia Hoffmanni und Pastinaca opaca repräsentiert. Dazu lichte Gruppen von Gypsophila paniculata und vereinzelte Serratula xeranthoides. Die Carduusarten verschwinden nach und nach, Lepidien und Sisymbrien sind tot, gelbe Achillea immer nur wenig, weiße fehlt fast ganz. Bald kommen wir wieder zur Irissteppe (I. notha), die diesmal mit Goebelia vergesellschaftet ist, oder weiterhin folgt Alhagi mit Artemisia. Dann wieder wird sie durch Goniolimon tataricum (beta) angustifolium, Alhagi und Zygophyllum Fabago in Anspruch genommen. Von rankenden Gewächsen wurde, niedrig am Boden bleibend, bisweilen schmarotzende Cuscuta bemerkt. Polygonum Fagopyrum klettert hier und da im toten [p.71:] Cichoriumgestell und Cynanchum acutum umwindet die Tamarixstämmchen. In dieser Weise geht es weiter bis zum S'ulak. Es wiederholt sich das Geschilderte immer wieder. Auch Iris notha und Artemisia maritima befreunden sich und sogar Peganum gesellt sich zu ihnen. Strichweise macht sich Rapistrum rugosum wichtig. Auch schaut vereinzelt der hohe Blütenstand von Silene viscosa aus der verdurstenden Kräuterflora hervor. Originell sind die immer von einander getrennt stehenden Exemplare von Serratula xeranthoides. Sie sind keineswegs exklusiv, leben mit allen anderen Arten in Frieden, aber, obwohl ausdauernd, trocknen jetzt an ihnen die tiefzerlappten Grundblätter schon ab, während die stark verästelte Krone blüht. Auf den salzigsten Stellen hatte sich Salsola verrucosa am besten und weitesten entwickelt und war reichlich mit wolligen Gallen besetzt. Unweit von ihr an hervorragender Kalkklippe wurde Ephedra procera gesammelt, umstanden war sie von hohen Bromusgruppen (Br. patulus) und Agropyrum cristatum. Vielfach beteiligte sich von den Gramineen auf dieser Strecke Aegilops squarrosa, ganz ausschließlich nahm sie große Plätze ein, und über das ganze Gebiet war Allium rubellum versprengt, es blühte jetzt.
Wenige Worte habe ich über die Flora an den unsicheren Ufern und in den Lachenerweiterungen der beiden obengenannten Bäche zu sagen, die das Meer nicht erreichen und hier blind verschwinden. Die Elemente dieser Flora kennt der Leser aus dem Delta der Wolga und vom Terek. Da walten überall dunkelgrüne und braune Farbentöne im Gesamtkolorit vor und die Ränder der Steppe heben sich scharf von diesen Sumpfpartieen ab. Schlank erhebt sich der Blütenschaft von Butomus umbellatus, an welchem sich die ersten Blumen erschlossen, aus dem einförmigen Grün der Typha- und Scirpus-bestände. Typha angustifolia und T. stenophylla haben abgeblüht und tragen bereits die jungen, dunkeln Walzenkolben. Juncus, Scirpus und Carices erreichen nur die halbe Höhe, in diesem Dunkel von Braun und Grün machen sich die hellen Blütenrispen einer Miliumart (?) sehr bemerkbar. Auf dem ruhigen, leidlich klaren Wasserspiegel schwimmen die Blättergruppen von Hydrocharis Morsus ranae und Polygonum amphibium, einmal wurden auch wenige von Nuphar, vielleicht von Nymphaea gesehen. Mit dem langsam flutenden Wasser sind die Triebe von Potamogeton crispus gerichtet, stellenweise floriert Ran. aquatilis an der Oberfläche und die Dragge brachte uns Ceratophyllum, aus den Stillungen dagegen Callitriche vernalis. Festeren Uferboden besiedelten eine ausdauernde Rumexart nebst Nasturtium palustre.
Wir müssen nun noch weiter ostwärts bis zum Meere wandern und die Vegetation betrachten.
Heftige Regengüsse hatten bis weit in die Steppe hinein den lechzenden Boden am 6. oder 7. Juni erquickt. Die Höhen der Salatawikette, bis fast 2740 m (9000 r. F.) hoch im Daghestan, lagen im frischen Schnee. Am Fuße des Gebirges schössen eilig die eigentlichen Burianpflanzen hervor. Die Sommerhitze förderte bei dem Überflusse an Feuchtigkeit erstaunlich rasch; die Steppenflora hatte das Stadium des Hochsommers erreicht. Schon trockneten die [p.72:] hohen Rumexstauden ab (R. crispus) und an den wilden Cichorien, die 3—4 Fuß hoch getrieben, erschlossen sich die ersten blauen Blumen. Phlomis tuberosa und Leonurus stehen in voller Blüte, an Eremostachys sieht man auf kahlen, blattlosen Stengeln nur noch die kolbigen Fruchtstände. Verbascum nigrum schoss hoch auf, es beginnt zu blühen. Linum austriacum trägt überall die reifen Samenkapseln. Auf den Ackerfeldern beginnt die Gerste zu reifen, schon haben sie den gelblichen Farbenton im Halm angenommen. Die wilden Rosen blühen überall.
Weiter östlich gegen Tschir-jurt hin, wo der Boden immer magerer, zwar noch fest, aber sandig ist, trugen die Distelarten überall die dicken, weißen Samenköpfe. So lange das Gebüsch der Ebene verbleibt, machen sich in ihm noch Gruppen von Salvia sylvestris bemerkbar, und überall ragt hoch über dem Grase Galium verum mit seinen gelben Blütenständen hervor. Hier und da vereinzelte Anchusa italica, hier und da filzige, massive Salvia Aethiopis jetzt in Blüte, dazu buschige Malva sylvestris, Stauden von Alcea filicifolia, reich beknospet, dann wieder streckenweise Goebelia alopecuroides, die ebenfalls zu blühen beginnt.
Hungersteppe in der Niederung des S'úlak. Wir nahen uns dem S'úlak, der mit voller Kraft den fesselnden Gebirgsschlund verließ. In seiner Niederung steht fast ausschließlich hoher, reichblütiger Astragalus galegiformis und dazwischen Tamarixgesträuch (T. Pallasii und T. Hohenackeri). Es wurden auch aus dem Gebirge einige Arten thalabwärts verpflanzt, so Gypsophila capitata, Cladochaeta candidissima, Salvia canescens und Psephellus dealbatus. Dann folgt tennenglatte Ebene, dürr, mager, arm, selbst die harten Festuca-Gräser verbrannten an der Sonnenhitze. Rhamnus Pallasii liegt als 1 Fuß hoher Krüppelstrauch am Boden, er wird immer seltener — nun fehlt er ganz. Wir befinden uns auf der Hungersteppe, in welcher selbst die ausdauernden Wermutstöcke kaum die Bodenfläche da etwas anschwellen, wo sie weitläufig zerstreut seit undenklich langer Zeit ihr kümmerliches Dasein fristen. Kaum dass noch in größerem Umfange sich Echinospermum zur Geltung bringt, selbst die Xeranthemumbestände bleiben niedrig und sehr licht.
Steppenflora am unteren Nordabhang des Gebirges bis zu 300m (1000 r. F.). Unsere Hoffnungen sind auf das Gebirge gerichtet, aber hier am Nordfuße des östlichen Endes der Hauptkette, wo ein mürber Sandstein gegen N. sanfter einfällt und gegen S. stets scharf von der Kammhöhe abbricht, werden wir in Bezug auf die Flora schmerzlich enttäuscht. Bis zu den Meereshöhen von 300 m (1000 r. F.) hat überall die Sonne die Vegetation vernichtet. Herrlich prangen diese Gehänge um die Mitte des Aprils. Hier sind sie dann an manchen Plätzen in 1 Fuß. Höhe vom Boden von den Blumen der Tulpen und Fritillarien bedeckt, von denen einige sich auch bis in die Ebene von Tschir-jurt wagten. Es sind Tulipa Gesneriana und eine Fritillaria-Art, die nach der Kapsel nicht zu bestimmen war, wahrscheinlich aber F. tulipifolia ist, welche LlPSKY bei Tschir-jurt fand. Kleinere Flächen erscheinen dann in den klaren Farben der Tulpen rein und gemischt, rot, matt weiß und gelb.
[p.73:] Die Tulpen sitzen tief im lehmigen, harten Boden, ihre Zwiebeln sind reichlich von braunen Hüllen umgeben. Fritillaria bevorzugt mehr sandigen Boden, man hebt die glatte, weiße Zwiebel leicht aus ihm. Dazwischen giebt es blühende Iris pumila, Helianthemum vulgare, Muscari sp. Von alle dem fanden wir nur die vergilbten Gerüste und zerplatzten Samenkapseln, zumal Helianthemum macht sich als 5—6 Zoll hohes hellbraunes Skelet an solchen sonnigen Stellen, die es bevorzugte, sehr bemerkbar. Auf den meisten der Tulpenhügel wogte jetzt Stipa (caucasica?), weniger häufig waren Bromus scoparius und der elegante Br. briziformis. Dazwischen standen steif halbvertrocknete Phlomis-stauden und die spirrige Centaurea maculata. Auch hier fehlte Malcolmia africana nicht und ebenso hatten sich Serratula xeranthoides und Leontodon asperrimum erhalten. Allium rubellum blühte. Noch ärmlicher sah es an den Felswänden selbst aus. Nicht einmal eine Capparisstaude, immer und immer wieder Zygophyllum und Peganum, die beide jetzt blühen, und graues Wermutblattwerk. Dazu kommt noch Erysimum versicolor und schwächliches Sisymbrium panonicum, allenfalls noch eine Gruppe von Onobrychis radiata, von Astragalus cruciatus und A. striatellus. An manchen Gehängen und auch zur Ebene hin glaube ich in den noch unentwickelten, aber gedrängt stehenden blaugrünen Pflanzenkomplexen Serratula glauca zu erkennen. Kleine Festuca-Plätzchen, Festuca ovina var. tenuifolia gab es überall. LlPSKY macht in seiner Arbeit »vom Kaspi zum Pontus« darauf aufmerksam, dass schon bei Tschir-jurt, also noch 54 km vom Meere landeinwärts, transkaukasische Pflanzenarten, die bis dahin an der Nordseite des Gebirges nicht nachgewiesen wurden, vorkommen. Er nennt als solche außer den beiden oben genannten Astragalus sp. und Onobrychis radiata, Medicago Meyeri, Vicia cinerea, Ononis Columnae, Sedum caespitosum, S. tetramerum und Valerianella-Arten. Auch einige wenige Westsibirier, z. B. Acanthia igniaria wurden von ihm gefunden. Später komme ich auf diese Erscheinung noch zurück.
Natürlich waren wir nach einer solchen Armut sehr begierig, den entfernter gelegenen »Wald« von Tschir-jurt zu sehen. Was man uns aber als solchen bezeichnet hatte und was wir weiterhin seitwärts vom S'úlak in den ersten beiden Thälern links und rechts vom Flusse kennen lernten, war nur karges Gebüsch. Ich habe nicht nötig das näher zu schildern. Aus allem sah man klar, dass, je weiter nach Osten, um so schwächer das Holz wird, wenn auch die Artenzahl leidlich reich bleibt. Mag sein, dass ehedem der Stamm hier besser gedieh und dass die übliche Raubwirtschaft ihn vernichtete, jedenfalls giebt es auf 12—15 km Entfernung von Tschir-jurt gegenwärtig keinen Wald mit Hochstämmen. Die Holzarten, aus denen das 10—15 Fuß hohe Gebüsch sich zusammensetzt, sind folgende: Acer campestre, Fraxinus excelsior, Quercus sessiliflora, Ulmus campestris, Evonymus verrucosus, Cra-taegus oxyacantha, Rhamnus Pallasii, Prunus spinosa, Cornus mas, Spiraea crenata, Pirus salicifolia selten, P. communis häufiger, Berberis vulgaris, Lonicera iberica, Ligustrum vulgäre, Cotinus coggyria (Rhus Cotinus) selten, Cotoneaster vulgaris. Nur über Pinus sylvestris muss ich einiges mehr sagen. Hoch am [p.74:] Gebirgskamme, der, nach S. gekehrt, senkrecht abbricht, stehen einzelne Kiefern. Alle sind gedrückt, wachsen krüppelig, langsam, erreichen kaum 15 Fuß Höhe und bieten hier dasselbe Bild, wie wir es aus der Darialschlucht später kennen lernen werden. Die Nadeln stehen dicht, sind kurz, nicht bläulichgrün, sondern fade gelblichgrün, die normal gebildeten Zapfen stehen meistens zu zweien gegenüber. Auch die Weinrebe kommt in dem Längenthale linkerseits vom S'úlak vereinzelt vor, man hat dieses Thal sogar nach ihr benannt, es heißt die »Rebenschlucht«.
Die Heuschläge werden durch Eryngium campestre arg verdorben, seine großen, steifen, lappig zerschnittenen Grundblätter sind bereits ausgewachsen. Hier sammelte ich folgende Arten:
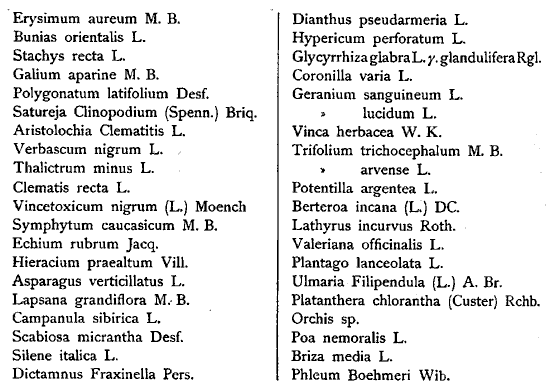
Hoch an kahlen, harten Kalkfelsen und im trockenen, kalkigen Lehm wurden gesammelt:
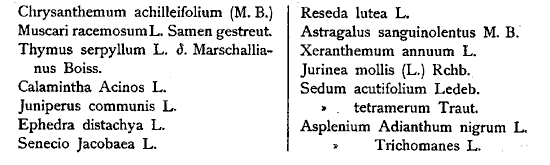
[p.75:] Man ersieht aus dem vorstehenden Verzeichnis, dass diese Flora nur wenige Steppenelemente in sich schließt und dass diese auch nur auf den äußersten Teil des Gebirgsfußes beschränkt bleiben. In der trockenen Umgegend von Tschir-jurt war die Moosflora arm, die der Flechten wenigstens der Masse der wenigen Arten nach reicher vertreten. Dürftige Lager von Peltigera canina und der fast weißen Parmelia laevigata wurden gehoben. P. caperata zeichnete sich dagegen obenher durch lichtes Seegrün aus. Cladonia alcicornis trug die Podetien, ebenso Clad. pyxidata. Die Hypnum-Polster waren oft von Cladonia fimbriata var. subcornuta durchsetzt, wogegen Clad. pungens vergesellschaftet mit Peltigera canina wuchs. Das tief dunkelgrüne Lebermoos: Madotheca platyphylla, welches bei Chassaf-jurt nicht selten war, fehlte hier und ebenso die zarten, niederliegenden Gewebe von Leskea polycarpa, die dort von Baumrinde gelöst wurde. Nur dürftig existierte in den sogenannten Wäldern an älteren Stämmen Hypnum cupressiforme, Barbula ruralis und Homalothecium sericeum und auch die grau schimmernde Grimmia pulvinata, ihre braunen Sporenbecherchen schauten überall nur ein wenig aus der winzigen Behaarung der rundlichen Polster hervor. Endlich sei noch Geaster hygrometricus erwähnt, der auf trockenen Gehängen vorkam. Kehren wir nach dieser Unterbrechung in die Ebene zurück.
Recente Kaspireste als Unterlage für die Hungersteppe. Auf der weiteren Strecke von Tschir-jurt bis Petrowsk am Kaspi haben wir einen namhaften Wechsel im Vegetationsbilde zu verzeichnen, wo ebensowohl nach der oberflächlichen Beschaffenheit des Steppenlandes, als auch nach der geologischen Bildung und Struktur seines Bodens, namentlich des hochliegenden Untergrundes, eine entschiedene Veränderung zu konstatieren ist. Es handelt sich nämlich dabei um den Beginn recenten kaspischen Meerbodens. Wir finden diesen klar aufgedeckt in 30 km Entfernung westwärts vom jetzigen Dünenstrand bei Petrowsk. Denn hier, kaum 1 Fuß tief unter leichtem Lehmsand, erscheinen, entblößt durch das Ausheben des Terrains zum Eisenbahndamme, jene hellbraunen mürben Muschelkalke, welche sehr oft noch wohlerhalten die gegenwärtig im Kaspi vorkommenden Cardiaceen lose verkittet in sich schließen, so sammelten wir z. B. Didacna trigonoides, Cardium crassum und Dreissena polymorpha. Bis zum Salzsee Temirgoje, wo das Gesagte in die Augen fällt und welcher See wohl nur der Rest einer Kaspilagune ist, magert die Steppe nach und nach ab. Zwar giebt es noch leidliche Grasflächen, welchen die letzten Regengüsse aufhalfen, mit eingesprengten Achilleen und Salvia sylvestris, mit niedrigen, jetzt überreifen Disteln, auch mit Ornithogalum narbonense und mit etlichen Weiden, die einem Kanäle entlang hier und da wachsen, aber die sogenannte Hungersteppe mit den unabsehbaren Wermutpocken (hervorragende Pusteln auf dem Boden) und den vertrockneten Festuca-Gräsern prävaliert.
Dünen- und Halophytenvegetation am Temirgoje-See. Die ersten 2—3 Fuß hohen Elymus-Gräser (E. sabulosus) immer in einzelnen, kräftigen Büscheln ziehen in der Nähe des Sees unsere Aufmerksamkeit auf sich, [p.76:] eine echte Sand- und Strandpflanze. Der Boden wird salziger, wo er ganz austrocknete ist er jetzt ohne Vegetation und weiß angehaucht. Zierliches Catabrosa humilis, kaum ½ Fuß hoch, von bräunlichem Farbenton, umsteht die Ränder salziger Pfützen. Flugsand macht sich bemerkbar, er ist gelb, seine Oberfläche kahl, der Wind trieb von NO., die parallelen niedrigen Wellengänge sind alle SO.—NW. gerichtet. Wo sich das Terrain bauschig hebt, da stehen die Gebüsche von Tamarix tetragyna und T. Pallasii, die ersteren schon verblüht. Dazu gesellen sich Nitraria-Gruppen (N. Schoberi) deren Äste mit einer dicken Borke von Physcia parietina bedeckt waren. Näher zum See, namentlich an seinem Ostufer, werden sie häufiger und dort auch stehen struppige 4 Fuß hohe Gebüsche von Halostachys caspica in dunkler, bräunlicher Färbung. Auch Kalidium caspicum ist vertreten, es bevorzugt die Dünen als Standort. Ganz wie in den transkaspischen Wüsten halten diese niedrigen Gebüsche den angetriebenen Sand- und Lössstaub fest. An ihrer Basis häuft sich das herangewehte Material mehr und mehr und sie bauen nach und nach die Bugri (siehe oben Krassnow) auf. An diesen kriecht das ausdauernde, harte Cynodon dactylon heran und auf dem fast weißen Lehm wächst in lichten Haufen eine sonderbare Statice (unbestimmbar) ganz blattlos zu dieser Jahreszeit. Eben auf solchen Bugris straucht Artemisia salsoloides und A. campestris (beta) canescens, beide im Colorit sehr verschieden, die erste hell bräunlich grau, die letzte bläulich, mehr grau als grün, beide 4—5 Fuß hoch. Unter ihrem Schütze besiedelten Moospolster von Bryum caespiticium, und zwar fruchtbare, den dürftigen Böden. Dann sieht man wieder, entfernter vom Ufer, den Salzrändern des vertieften Lehmbodens folgend, Camphorosma ruthenicum in kompakten Bändern und weiter seitlich die Kombinationen von Alhagi, vertrockneter Phlomis, toter Festuca und alles das von spirriger Crupina in lichtester Verteilung überragt. Die genügsame Salvia sylvestris wanderte vereinzelt bis an den Rand des Sees, da wo er erhöhten, nicht gar zu salzigen Boden besitzt, und ihr schließen sich sogar Teucrium Polium und Ajuga Chia an. Auch Lepidium crassifolium, schon in Samen, fand ich an solchen Plätzen, den Lehm suchend und über den Boden hin liefen die Ranken von Cynanchum acutum, eine der wenigen großblättrigen Pflanzen, sie klettert gerne in das Tamarix-Gebüsch. Auch Senecio vernalis fehlt hier nicht. Zur Vervollständigung dieser Schilderung muss ich den Leser noch an die abgesonderten Salzpfützen führen. Frankenia hirsuta (beta) intermedia malt an ihren Rändern niedrige dunkle Flecken mit ihren dichten Blattquirlen, aus denen die violetten Blumen schon hervordrängen, und auf mehr sandigem Boden siedelte sich Spergularia marginata in Massen an. Die Salsola und Suaeda sp. waren in ihrer Entwickelung noch sehr zurück. Man konnte sie der Art nach noch nicht erkennen. Ich deute die blaugrünen Flecken, welche durch 3—4 Zoll hohes, dichtgedrängtes lineares Blattwerk gebildet werden, auf Salsola Soda (?). Ich fand sie später, Ende Juli, ebenda in 1 Fuß Höhe schon erkennbar. Dagegen machte Salsola verrucosa keine Mühe und auch Salicornia herbacea, jetzt 4—6 Zoll hoch, wurde zweifellos erkannt, [p.77:] beide lebten nachbarlich, aber einander ausschließend. Endlich dehnen sich, schon in größerer Entfernung vom See, Xeranthemumfelder vor unseren Augen. Jetzt (Juni) glitzern auf ihnen im Sonnenschein die stark angeschwollenen, silberweißen Endknospen der Blütenköpfe 1 Fuß hoch über dem bleichen, mageren Boden, in Zeit von 8—10 Tagen wird ein angenehmes Rosa an Stelle dieses Silberschimmers treten und sich lange erhalten. Xeranthemum gehört zu den sogenannten Immortellen, deren papierartige Hüllblätter wie bei Statice und Acantholimon nur den anhaltenden Regengüssen und Stürmen des Herbstes verfallen. Gar zu heftige Sonne versengt aber auch Xeranthemum. Die von ihm bestandenen Flächen haben einen ganz besonderen, feinen Schmuck angelegt. Ich meine damit die durchsichtig locker aufgebauten Kugelformen blühender Gypsophila paniculata. Äußerst zart in ihrem weiten Umfange und ebenso fein in dem Bau der kleinen, unzähligen Blüten, hat sich diese Pflanze seit Jahren schon ihren wohlverdienten Platz in der Kunstgärtnerei verdient. Hier in ihrem Vaterlande verleiht sie der Xeranthemum-Steppe viel Eleganz und Eigenart. Wo sich der Boden mehr senkt und feuchter Lehm, wenn auch schon etwas salzig, herrscht, sprießt weitläufiges Rohr aus den Gruppen von Galega officinalis hervor und diesen Stellen schließt sich auf höherem Terrain die Anthemis-Steppe (Anth. ruthenica) an, aus welcher einzeln Alcea ficifolia und Verbascum nigrum, beide mit ihren ersten Blumen geschmückt, hervorragen.
Dünenflora am NO.-Fuß des Kaukasus am Kaspi. Nunmehr wurde das Meer erreicht. Der NO.-Fuß des Kaukasus tritt hier vom 730 m (2400 r. F.) hohen Tarku-tau in nicht sehr starker Neigung zu ihm heran. Aber vor ihm glänzt an dem nach N. verlaufenden Strand eine Reihe von hellgelben Dünen uns entgegen. Sie sind teilweise mit Silberpappelgesträuch bedeckt, aus welchem einzelne starke Bäume von Populus nigra hervorragen. Der Wind spielt mit den untenher weißen Blättern des erwähnten Gebüsches und das macht auf dem hellgelben Grund der Dünen einen angenehmen Effekt. Diese verhältnismäßig gut bewachsene Dünenzone, die sich weit nach N. hinzieht, setzt sich aus einer Reihe alter fester, leidlich benarbter Sandwellengänge zusammen, welche dem Meeresufer parallel laufen. Die Fronten der unmittelbar am Meere gelegenen Dünen sind hart, fast ganz kahl. Es giebt auf ihnen zwei Sandarten. Die gröbere besteht wesentlich aus Muscheldetritus und ist rötlich gelb, die feinere grau. Hier beginnen zwei Pflanzenarten ihre mühselige Arbeit, nämlich die Befestigung dieser Dünen. Die eine ist der kräftige, harte Elymus sabulosus, die andere Convolvulus persicus. Die letztere ist in dieser Hinsicht noch nützlicher als die erstere und arbeitet ihr gewissermaßen vor. Man kann ihre etwa federkieldicken, schnurgeraden, oberflächlich im Sande verlaufenden Wurzeln oft mehrere Faden weit verfolgen. Sie sind hellbraun, etwas durchscheinend und leicht brüchig, zart gebaut, leidlich saftig. Aus ihnen entwickeln sich, oft erst in 7—10 Fuß Entfernung voneinander, die beblätterten Stengel, meistens vereinzelt, sie kriechen auf dem Boden fort. Im Gegensatze zu den Stengeln, Knospen und Blättern, die allseitig [p.78:] gleichmäßig dicht befilzt sind, blieben die Wurzeln nackt. Die elliptische Blattfläche ist diesem weichen, verwebten Wollkleide gegenüber verschwindend dünn. Solche weitläufigen Wurzelnetze kreuzen sich oft, durchlaufen den lockeren Sand weithin, werden, wenn es stark wehte, kahl gefegt und trocknen dann an der Sonne. Sie bilden großmaschiges Gitterwerk, in dessen Rauten sich Elymus gerne ansiedelt, der dann die äußerst zähen seitlichen Wurzeltriebe nach allen Seiten in den losen Boden treibt und überdies stolonifer ist. Wo die harten Spitzen der Blätter dieser Elymus-Gräser, zufällig geknickt, den Sand berühren, was oft stattfindet, und vom Winde regelmäßig hin und her bewegt werden, graben sie Kreissegmente, sogar bis zum Halbkreise, in den Sand. Anders kann man sich solche Bogenlinien zu Füßen der Elymus-stände nicht erklären. Bald auch gesellen sich Carex arenaria und C. Schreberi dazu, die zwar nicht dicht, aber dafür überall auf solchem Terrain wachsen. An der Befestigung des Dünenbodens beteiligen sich ferner Aeluropus littoralis, auf älterem Boden Convolvulus arvensis, namentlich Plantago maritima und Pl. arenaria, weniger Pl. lanceolata und Tribulus terrestris. Tiefer landeinwärts sind die alten Dünenwellen, besonders in ihren flachen Thälern besser bewachsen. Die jungen, dem Meere am nächsten, mögen wohl 40 Fuß über dem Spiegel des Kaspi sich erheben, die älteren 20—25 Fuß, und je mehr der Ebene nach W. hin auch noch weniger, 10—12 Fuß. Das gesamte Dünenfeld mag hier die Breite von 1 km besitzen. Eine für diese Gebiete charakteristische Pflanze ist die ausdauernde, lauchgrüne Artemisia salsoloides, deren diesjährige Triebe schon 3 Fuß hoch sind und in dichten Büschen stehen, aber noch keine Blütenknospen tragen. Die Pflanze ist durch ihren kriechenden, dicken, spiralig gewundenen und obenher förmlich zerborstenen Grundstock ausgezeichnet, der fast schwarz und in Armdicke erscheint. Wo der Oststurm solch' einen alten Grundstock auswehte, da stirbt die Pflanze ab. Überall sieht man neben den frischgrünen Gestrüppen auch tote, welche die hohen verholzten Stengeltriebe früherer Jahre gleich spirrigen Besen in die Luft strecken. Auf dieser Wermutart schmarotzt häufig eine Phelipaea-Species, die schon vertrocknet war. Die schönste Dünenpflanze, welche ich hier in voller Blüte fand, ist ein Astragalus, der im Habitus sehr an A. hyrcanus erinnert, aber vom Monographen dieses schwierigen Geschlechtes, von Herrn Freyn als neue Art erkannt und A. barbidens benannt wurde. Er macht bis zolldickes Holz und treibt aus ihm zimmetfarbene Stämmchen, 2—3 Fuß hoch, um an den Spitzen die vollbesetzte, intensiv rosa gefärbte Blumenähre das silbergraue, gefiederte Blattwerk übergipfeln zu lassen. Die Dünengründe zwischen je zwei Wellengängen sind oft recht gut bewachsen und können allenfalls zum Heuschlag verwendet werden. Am bemerkbarsten macht sich da die 3—4 Fuß hohe Jurinea polyclonos, deren dunkelviolette Blütenköpfe schon erschlossen waren. Sie steht mitten in wilder Luzerne, aus welcher auch hier und da Sisymbrium pannonicum und schlank aufgeschossene Gypsophila paniculata sich erhoben. Kleine Bestände von Dodartia orientalis und Galega sp. fehlen nicht. Centaurea alba = C. leucolepis tritt nur vereinzelt [p.79:] auf, gleich der Jurinea fällt sie durch Höhe und die roten Blumen sehr ins Auge. An anderen Stellen wechseln gelb- und weißblühende Achilleen ab, gelbes Galium verum behauptet seine Reviere und den Boden bedeckt kriechende, weißblühende Asperula humifusa. Xeranthemum annuum schiebt die zugespitzten Blütenknospen hervor und Cuscutagewebe, jetzt der Art nach nickt zu erkennen, von gelbrötlicher und brauner Farbe, überwucherte einzelne Plätze derart, dass man sie kaum betreten mag. An den trockeneren Gehängen breteten sich immer um ein Centrum die ungezählten Triebe von Scorzonera ericsperma aus; sie bilden abgesonderte Gruppen, deren peripherische Blütenstände einen Umfang von 4—6 Fuß bezeichnen. Dort auch steht vereinzelt, in allen Teilen dicht mit Stachelhaaren besetzt, Onosma echioides, dazu schmalblättrige Euphorbia Gerardiana und Erysimum leptostylum. Von den statlichen Doldengewächsen ist Hippomarathrum (Cachrys) crispum zu nennen, aus ihren elegant feinzerschlitzten Grundblättern trieben die schlanken Blütenschäfte mit den endständigen gelben Dolden hervor. Auf feuchteren Gründen entwickelte sich, dünn verteilt, Phragmites, dazwischen sah man Scirpus Holoscloenus (gamma) australis, welcher durch die seitwärts stehenden Kugelköpfchen der Blüte so auffallend wird und mit den perennen Wurzelstöcken sehr tief im Boden sitzt. An solchen Stellen fand sich auch Equisetum ramosissimum. Schauen wir uns nach Gramineen um, so wäre Calamagrostis littorea besonder zu erwähnen, weil sie in den Senkungen des Bodens oft massig auftritt. Dem Sande fügte sich Bromus squarrosus, mehrere Agropyrum-Arten, darunter Agr. elongatum, treten nur in geringer Menge auf. Aber häufig waren auf festem Boden Hordeum murinum, Lolium perenne und L. rigidum. Die nutzbarsten Reviere waren auch hier von Eryngium campestre verdorben. Noch muss bemerkt werden, dass außer dem Silberpappelgebüsch (nie Baum) sich auch Tamarix, seltener Crataegus monogyna, natürlich auch Rhamnus Pallasii ansiedelten. Auffallend war, dass Thymus Serpyllum (delta) Marschallianus von nahen Gebirgsfuße sich auf den Sand begeben hatte, wobei die Blütenschäfte zwar behaart, die Blätter aber ganz glatt blieben. Die Exemplare krochen weit am Boden um eine Mutterpflanze hin. Auf zwei Rückenflächen der alten, festen Dünen waren ehemalige Weingärten offenbar verlassen und verwildert. Ihre Reben von reichlich Zolldicke lagen hart auf dem sandigen Boden, hatten ohne Deckung im Winter trotz der exponierten Lage vom Frost nicht gelitten und blühten jetzt. Die untere Seite ihrer Blätter war ülerall wollig behaart, die obere glatt.
Wanderungen transkaukasischer Arten in der Uferzone. Mit dem Besuche der Dünen von Petrowsk haben wir nun das Steppengebiet in seiner Osthälfte erledigt, aber bevor ich aus dem Geschilderten im Anschlusse an die Steppen der Westhälfte und mit Benutzung der auf sie bezüglichen Litteratur einige allgemeine Schlussfolgerungen ziehe, will ich noch den Gebirgsfuß bei Petrowsk betreten, und zwar an der Seite LlPSKY's, welcher hier 1891 arbeitete. Wir befinden uns da auf Kalkboden (alte aralokaspische Bildung) und es treten mit der Erhebung des Terrains die echten Steppen- [p.80:] formen zum größten Teile ganz zurück oder sie werden doch viel seltener. Dagegen kommen einige Species, die bis dahin nur in Transkaukasien (siehe oben Tschir-jurt) gefunden wurden, hier vor, was uns die Frage aufdrängt, welchen Weg solche Species einschlagen mussten, da weder das Hochgebirge noch der Wald oder die Salzwüste sie passieren ließen. Durch Küstenwanderung muss die Übersiedelung stattgefunden haben entlang dem Ostfuße des Gebirges, welches einst vom Meere bespült wurde. Diese Straße der Wanderungen liegt nicht allein für die Pflanzen, sondern auch für viele Zugvögel der Küste entlang vom unteren breiten und flachen Kura-thale über Baku und Derbent, für manche Arten direkt dem Strande entlang, für andere in den niedrigeren Gebirgsteilen der abfallenden Ostfronten.
Das südlich dominierende Gebirge von Petrowsk gipfelt in dem Tik-tübe mit 720 m (2370 r. F.), seine Nord- und Westgehänge sind bestraucht. Rhamnus spathulifolia, krüppeliges Eichengestrüpp, Rhus Cotinus, Evonymus latifolius kommen da vor, dazwischen siedeln sich manche Waldpflanzen an, sogar Allium paradoxum. Auch unter diesen giebt es mehrere, die bis jetzt nur aus Transkaukasien bekannt waren, z. B. die seltene Nonnea decurrens, Veronica ceratocarpa. Die dem Meere zugekehrte Seite des Gebirges ist fast kahl. Hier fand LlPSKY die Mehrzahl der kaukasischen Valerianella-Arten, alle nahe bei einander, und dazu Solenanthus petiolaris, welche bis jetzt nur in Persien und Mesopotamien gefunden wurde. Von der Uferklippe, auf welcher Petrowsk erbaut wurde, ist das Tik-tübe-Gebirge durch eine tiefe Einsenkung getrennt. Auf dieser vorderen Klippe herrschen charakteristische Kalkpflanzen vor. Haufenweise drängt sich Parietaria judaica aus den Spalten der kahlen Felsen. Unmittelbar dem Meere entlang fasst eine Bordüre von Tournefortia Arguzia den Strand ein. Wo sich ihm Lehmflächen anschließen, vergesellschaftet sich Papaver arenarium mit Senecio vernalis, dazwischen stehen Melilotus-Stauden, Cynanchum acutum wirft seine belaubten Rankenknäuel auf die Felsblöcke und die Mohnblumen frischen das Kolorit solcher Partieen angenehm auf. In den Vertiefungen des Bodens zwischen überragenden Felsen siedelte sich Fumaria Vaillanti an, aber wo wir auf freiere lehmige Ebene treten, herrscht Anthemis ruthenica und wechselt mit Achillea setacea und Acroptilon picris ab. So das Ende der Steppe auf lehmigem Boden. In den trockenen Steilhalden, mit denen jene Klippe gegen N. sich ins Meer senkt, wuchert das unantastbare Echium italicum = E. altissimum und verbreitet sich von da, nach und nach rarer werdend, bis weit in die Lehmsteppe hinein. So unten. Höher nehmen niedrige Kleearten, Trifolium procumbens, scabrum und striatum, sowie Medicago Gerardi fast ausschließlich die Neigung und Rückenfläche des Kalkhügels ein. An trockenen Stellen bedecken im Frühling Sedum caespitosum und das zwergkleine S. tetramerum kleinere Strecken des Gesteins; sie verschwinden im Sommer ganz, weil sie annuell sind. Stipa Lessingiana und der schöne Bromus briziformis, sowie Herniaria incana und Queria hispanica bewohnen diese trockenen Höhen. In [p.81:] den feuchteren Vertiefungen des Bodens siedelten sich Trifolium subterraneum und Eufragia latifolia an.
Schlussfolgerungen. Nach dieser kurzen Abschweifung und bevor ich dem Leser die Steppen Transkaukasiens zur Kenntnis bringe, überschaue ich nochmals das bis jetzt erörterte Gebiet und komme dabei zu folgendem Schlussergebnis :
1. Entlang dem äußersten Nordfuße des Kaukasus wird die specifische Steppenflora der Schwarzerde mannigfaltig durch das Eindringen mancher Waldpflanzen aus dem Gebirge beeinflusst. Auf dem Erhebungsrücken Stawropols, der zur Wasserscheide zwischen Terek und Kuban wird, macht sich dieser Einfluss am weitesten gegen Norden bemerkbar.
2. Westlich von dieser Wasserscheide prävaliert die schwarzerdige Steppe, je weiter vom Gebirgsfuße entfernt, um so reiner und typischer, sich der südrussischen, zunächst der donischen anschließend.
3. Östlich von dieser Wasserscheide greift der kaspische Wüstentypus mächtig in den der Steppe ein. Schon am Kalaus und östlichen Manytsch dominieren Salz- und Sandsteppen in Übergängen lokal bis in die Extreme. Je näher am Westufer des Kaspi, um so mehr gewinnen sie die Oberhand. In der gegenwärtigen Uferzone des Binnenmeeres und im Gebiete der ehemaligen Ufer des Kaspi zur jüngsttertiären Zeit kommt der aralo-kaspische Wüstentypus streckenweise zur vollen Ausbildung.
4. Der Kamm des kaukasischen Hochgebirges setzt mit seiner hochalpinen Region und den Hochpässen in ihr allen Steppenpflanzen eine unübersteigbare Grenze. Dieselben konnten aber, indem sie um den östlichen Gebirgsfuß und seine nächstgelegenen niedrigen Höhen wanderten, in das Hauptthal Transkaukasiens (Kura) gelangen. Von Westen her war ihnen am Pontus eine solche Verbreitung der Küste entlang sehr erschwert und für manche Arten unmöglich, weil die große Nässe des kolchischen Gebietes auf der Strecke von Sotschi bis jenseits Batums fast von keinem Steppengewächse auf die Länge der Zeit überdauert wird und solche Arten auch in der Gegenwart entweder gar nicht oder nur als vorübergehende seltene Ausnahmen zu finden sind.
5. Ebenso scharfe Grenzen zieht der hohe Nordfuß des Albursgebirges am Südufer des Kaspi westwärts den transkaukasischen Steppenpflanzen, ostwärts den transkaspischen Wüstenpflanzen. Auch in diesem Falle liegt der Grund dafür in den starken Niederschlägen, die von der Gäsküste an bis in das russische Talysch den Tieflanden Massenderans und Gilans zu gute kommen.