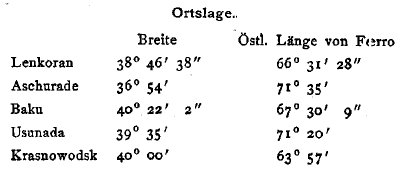
[Radde, Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländern] Kapitel 3
[p.194:] Drittes Kapitel. Talysch [Anm:Wer über das russische Talysch ausfuhrlichere Nachrichten wünscht, der findet sie in »Reisen an der persisch-russischen Grenze (Talysch und seine Bewohner)« und in »Die Fauna und Flora des südwestlichen Kaspigebietes«. Beide Werke sind von mir verfasst und bei F. A. brockhaus in Leipzig 1886 erschienen.]
Geographische Orientierung S. 194. Klima S. 195. Dünen- und Tieflandsflora S. 197. Die Morzi S. 199. Kleewiesen S. 200. Die Wälder des Tieflandes S 200. Gebirgswälder S. 204. Die Hochebene von Ardebil S. 206. Schlussfolgerungen S. 206.
Geographische Orientierung. Wir sind durch die Verzeichnisse des vorangegangenen Abschnittes ganz von selbst in diejenigen Gebiete der Kaukasusländer gekommen, welche ihrer Vegetation nach den kolchischen am ähnlichsten sind, nämlich an die Südküste des Kaspi. Diese Ähnlichkeit hat ihren Grund in dem entsprechenden Relief und der dadurch bedingten Regulierung der Niederschläge. Wie dort im westlichen Kolchis gegen N. und NO. die hochgipfelnde Kaukasuskette den Schärfen des kontinentalen Klimas eine Grenze setzte und zugleich an ihrer Südfront den Überfluss von Feuchtigkeit, welcher aus SW. herangetrieben wurde, niederschlug, so schlürft hier im Osten 5—6 Breitengrade südlicher am Südufer des Kaspi das hohe iranische Randgebirge die Exhalationen des großen Binnenwassers auf und führt sie in mehr als hundert Bachsystemen wieder demselben zu, um von neuem den Kreislauf der Feuchtigkeit vom Dampf zum Wasser zu vermitteln. Das geschieht zwischen den Breiten 39—36 und zwischen den Meridianen 66—75 östl. von Ferro, welches Areal das System des Alburs einnimmt. Sein centraler Teil tritt vom Meere weiter zurück, gewinnt an Breite (reichlich 100 km), ihm ist auf einer dem Rande nahen Parallelkette der höchste aller vorderasiatischen Vulkane, der Demawend, dem Elbrus ebenbürtig, aufgesetzt (ca. 5700 m, trigonometrisch: Lemm 18846 r. F., Stebnitzky 18600 r. F.). Das vorliegende Uferland des Meeres — die Gässküste, Massenderan, Gilan, Talysch — befindet sich klimatisch in fast gleichen Verhältnissen, wie die bevorzugtesten Lokalitäten von Kolchis. Aber der Abschluss gegen Westen
[Tafel??] Erklärung der Tafel. Hohe Vegetation nahe der Baumgrenze an der Südseite des Großen Kaukasus im Hochthale der Nakra auf nassem Untergründe und durch lange dauernde Schneeschmelze erweichtem Boden in ca 1980 m (6500 r. F.) Meereshöhe von V. sella aufgenommen. Doldenpflanzen von 8—9 Fuß Höhe (Heraclenm pachyrhizum Somm. et Lev.? [die Species ist in A Travers le Caucase p. 168 abgebildet, aber nicht genannt]) und anderweitig auch großblättrige Heracleum-Arten im Verein mit Aconitum variegatum und A. Orientale, mit Campanula lactiflora, C. latifolia, Delphinium speciosum, dazu auch Telekia speciosa und Cepha-laria tatarica, sowie Mulgedium tataricnm kombinieren in dichter Anordnung die hochstrebenden Formen, welche den Reiter zu Pferde überragen. Tiefer am Boden drängen sich zwischen mächtigen Petasites-Blättern Lilium monadelphum, Pyrethrum macrophyllum und Astrantia helleborifolia hervor. Von den freien Wiesen dringen Cirsium obvallatum, C. munitum und C. fim-briatnm samt Innla grandiflora nnd I. glandulosa, auch Senecio nemoralis und aurantiacus in die Randzone solcher eigenartigen Kolossalflora ein. Der Wald wird hier durch dichtere Gruppen überstandener Nordmannstannen, die oft walzenförmig schmal gebaut sind, durch vollkronige Weißbirken und vereinzelt darin versprengten Acer Trautvetteri zusammengesetzt. (Aus douglas W. freshfield, The exploration of the Caucasus Vol. II p. 199.)
[p195:] und namentlich der gegen Osten geschieht nicht so allmählich, wie wir dies am Pontus konstatieren konnten. Scharf zieht die Wüste Transkaspiens ihre Grenze schon nahe von Astrabad und es giebt da in unmittelbarer Nachbarschaft zwischen der Gässküste mit den Wüsten am unteren Atrek in floristischer Hinsicht gar keine Vergleichspunkte. Tag und Nacht sind von einander nicht so scharf geschieden, wie diese beiden Naturtypen, die trockene, lehmige, sandige, oft salzige Wüste und das sumpfige (Süßwasser-) Tiefland am südlichen Kaspiufer. Auch westwärts auf russischem Gebiete zieht der südliche Rand der Mugan als ehemaliger Kaspiboden korrekte Linien dem verflachten Gebirgsfuße entlang, aber der Abfall desselben zur Steppe gegen Norden ist bei weitem nicht so schroff. Wo im Verlaufe der Jahrtausende durch die Arbeit der abströmenden Regenwasser der Rand ausgesüßt wurde, bildete sich die Steppe vorteilhaft aus, nach und nach verschwanden die ursprünglichen Halophyten und die späteren Artemisien, es folgten Gramineen und andere Steppenpflanzen. Wo dagegen von den Ostfronten des talyscher Gebirges die zahlreichen Abflüsse zum Kaspi stürzten und die kleineren ihn nicht erreichten, weil ihr Andrang die vorlagernde Zwergdüne nicht bezwang, da staute das Süßwasser im Tieflande an und bildete ganz wie in Massenderan ein weit ausgezogenes Sumpfland mit seeartigen, stagnierenden Wasserbassins, die vom Meere oft nur durch schmale, feste Dünen und ausgeworfene Cardienwälle getrennt sind.
Nur ein kleiner Teil vom Alburs kommt für uns hier in Betracht. Es ist sein NW.-Ende, soweit es Russland seit 1829 gehört. Er dehnt sich dem Meere entlang von oberhalb Lenkoran (Kumbaschinsk) bis zum Astara-Flüsschen ca. 50 km aus, bei einer mittleren Breite von 20—70 km und mit Höhen im Randgebirge von 1500—2500 m (5000—8300 r. F.). Ihm schließt sich gegen SW. die Hochebene von Ardebil mit dem darauf gipfelnden 4813 m (15 792 r. F.) hohen Sawalan an.
Was die botanische Physiognomie unseres talyscher Gebietes anbelangt, so wird sie im Wesentlichen derjenigen Gilans und Massenderans gleichkommen, dort aber in den räumlichen Verhältnissen größer sein, jedoch dieselben Species und Formationen darbieten.
Klima. Bevor ich jene Uferstrecken botanisch näher schildere und dann einen Aufstieg im Grenzthale der Astara bis zur Höhe des Randgebirges mache, gebe ich für Lenkoran und die Insel Aschurade die meteorologischen Werte und füge ihnen die Gegensätze von den Plätzen am W.- und O.-Ufer des Kaspi hinzu.
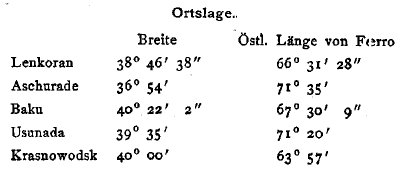
[p.196:] Monats- und Jahresmittel der Temperaturen in Celsius., Absolute Maxima und Minima der Temperatur., Maß der Niederschläge in mm., Verteilung der Niederschläge im Verlaufe des Jahres nach Tagen.
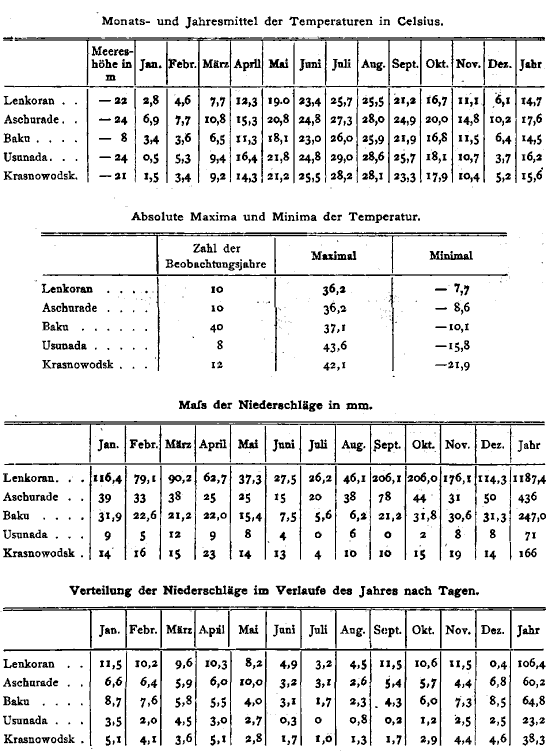
Die Windrichtungen anlangend, so ist die SW.-Ecke des Kaspi vor dem nördlichen Teile des Binnenmeeres bevorzugt. Während für Baku die meist steifen, oft orkanartigen Nordwinde mit 45,2 % im Jahre ermittelt wurden, er-giebt sich ihr Procentsatz für Lenkoran nur zu 5,2.
[p.197:] Die Tabelle für Baku und Lenkoran stellt sich folgendermaßen zusammen:

Die bisweilen plötzlich aus W. und SW. einfallenden heißen Stürme haben in Lenkoran niemals eine lange Dauer. Wenn wir die meteorologischen Tabellen aus dem kolchischen Gebiete mit den eben zusammengestellten vergleichen, so schließt sich Lenkoran in seinen klimatischen Verhältnissen am besten an S'uchum. Bei fast gleicher mittlerer Jahrestemperatur ist der Hochsommer in S'uchum etwas kühler, der Winter dagegen durchschnittlich um reichlich 2°C. wärmer. Die jährliche Regenmenge erweist für S'uchum nur ein Plus vom 31 mm, aber die Verteilung der Niederschläge weicht ab. Lenkoran hat trockene Sommer. Vom April an bis August incl. fallen in S'uchum 306 mm mehr als in derselben Zeit in Lenkoran, dagegen beläuft sich das Plus vom September bis Ende Dezember für Lenkoran im Gegensatze zu S'uchum auf 264 mm.
In Folge so günstiger Bedingungen erneuert sich nach verhältnismäßig trockener und heißer Sommerzeit die Bodenflora im Herbst in vielen Arten und die Wälder werfen selbst in Höhen von gegen noorn (3600 r. F.) erst im November das Laub. Anfangs Dezember prangen in normalen Jahren die Eichen im Tieflande noch in vollem Laube und Parrotia, welche dasselbe am längsten trägt, verfärbt sich erst gegen das Jahresende vom saftigen Grün in Rot. Ich gebe die phänologischen Beobachtungen, welche ich 1879—80 in der Umgegend von Lenkoran machte, hier nur im Auszuge.
Am 10. Dezember trieben die Passifloren im Garten. Ricinus steht in voller Kraft, hat 20 Fuß Höhe bei 4 Zoll Stengeldurchmesser erreicht. Feigen, Gleditschia und Albizzia sind entlaubt. Im Garten blühen noch alle Sommergewächse, auch zarte Maurandia.
Dezbr. 27. Erster Frost (—1,75). Cyclamen coum beginnt zu blühen.
Febr. 1. Veronica agrestis blüht. Weidenkätzchen.
6. Erlen und Haseln stäuben noch nicht.
10. Erste Schneeglöckchen im Walde.
März 3. An den Eichen die Blattknospen zum Platzen, an Syringa ebenfalls. Brennessel 4 Zoll hoch. Primula acaulis var. iberica, Cyclamen coum, Scilla Hohenackeri, Viola odorata blühen, etc.
Dünen- und Tieflandsflora. Wer von Norden kommt, wird, in welcher Jahreszeit es auch sein möge, nachdem er die unabsehbare Mugan-Steppe mit ihrer Halophyten- und Artemisien-Decke und — dem Wasser näher — mit ihren Rohr- und Chenopodien-Beständen passierte und sich dem Meere näherte, am südlichen Horizont durch das Auftreten der talyscher Gebirgslinien hoch erfreut. Die ermüdende Einförmigkeit der Ebenen hat ein Ende und mit den hochliegenden Horizontlinien wird auch ein Wechsel in der [p.198:] Vegetation stattfinden. In der That beginnt ein solcher schon wenig unterhalb vom südlichen Kura-Arm, der Akuscha, wo der Salzgehalt der Mugan schwand und fruchtbare Alluvionen die Oberfläche bilden.
Die großen und reichen Molokanen-Dörfer von Andrejewka bis Niko-lajewka, letzteres schon nahe am Südende des Kisilagatsch-Busens gelegen, bezeugen diesen günstigen Wechsel. Hier sind die Halophyten und der Wermut verschwunden, es grünen die natürlichen Wiesenpläne auch im Winter und nur ausnahmsweise wird das Land von den Unbilden des Wetters für kurze Zeit heimgesucht, wenn der andauernde Nordost Kälte und Schneewehen ' bringt. Mit dem Betreten der festeren Uferdünen, über welche unser Weg gegen Süden führt, gingen die letzten Spuren der Muganflora verloren, sofort tritt die Rubus-Dschungel in ihre Rechte, die sich hier vorwaltend aus einer besonderen Art, Rubus Raddeanus Focke, aufbaut. Die vielen geschmeidigen Zweige dieses Strauches, welche, wenn sie die Erde berühren, Absenker machen, legen sich breit aus und neigen sich im Bogen, zumal wenn sie reichlich Beeren tragen, zu Boden, wie das ja auch bei alten Brombeersträuchern 'stattfindet. In der reinen Dschungel, die nur von diesem stark bekrallten Gebüsche gebildet wird, will sich nicht leicht eine andere Pflanze gefallen. Zu Füßen dieser über 2 m (5—8 r. F.) hohen Dickichte herrscht Dämmerlicht und Trockenheit, denn das große, etwas steife Laubwerk oben am Lichte deckt vollkommen die unteren Partien. Anders ist es auf den Lichtungen der Dschungel: da stehen Granatengebüsche, krüppelige Rüstern, verwilderte Maulbeerbäume, ja sogar Weißdorn, Wildbirnen und Alutscha-Pflaumen (Prunus insititia, Pr. divaricata). An Vertiefungen, wo es Feuchtigkeit giebt, wird das alles üppiger, wächst höher und es gesellt sich auch noch die Esche hinzu. Der reinen Dschungel gehört auch Gleditschia caspica freilich hier im nördlichen Teile derselben nur als Seltenheit an. An den genannten Sträuchern und Bäumchen beginnen Smilax excelsa und Periploca graeca sofort ihre Arbeit. Die letztere ist die eigentliche Liane, sie schlingt in der That, würgt und tötet, Smilax klettert, umstrickt mit tausendmaschigem Netze, geht bis in die höchsten Kronen der Bäume und übt an ihnen sein Weberwerk aus, aber die Triebe legen sich nicht so fest an die stützende Unterlage an, und die Spirale, mit welcher Periploca typisch wächst, geht dem geradeaus kletternden Smilax ab. Die Dschungel ist dauerhaft dunkelgrün, verfärbt sich in rotbraun. Das Laub an Rubus Raddeanus wird hier unter dem 38° n. B. fast ausdauernd. Erst im Januar, wenn die neuen Blattknospen schon schwellen, fällt der größte Teil des alten Laubes, aber nie alles. Auch blüht die Pflanze bis spät in den Dezember hinein und es giebt immer Beeren, die aber niemals recht saftig werden.
Die magere Frühlingsflora bringt uns mancherlei rasch vergehende Steppenformen, schon Anfangs Mai sind sie dahin. Da sehen wir Alyssum minimum und Lepidium filifolium. Silene gallica, S. conica, dann hart am Boden niederliegendes Medicago minima, M. orbicularis, zwischen den lang ausgestreckten Ästen von Erodium oxyrrhynchum blüht Veronica agrestis. Auf trockener
[p.199:] Dünenhöhe vergesellschaftete sich Scleranthus annuus mit Sedum pallidum und Euphorbia Peplis. Dazwischen steht nacktes Gestrüpp von Ephedra und die schwächlichen Bromus- (B. tectorum) und Poa- (P. annua) Halme werden vom leichtesten Winde geschaukelt. Jede Vertiefung dieses Dünenbodens bringt uns eine bessere Vegetation, wenn auch noch nicht mit geschlossenem Rasen. Schon sehr zeitig bauen sich in halber Kugelform die großen Knäuel der Grundblätter von Prangos foeniculacea auf, aus deren Centren Ende Mai die mächtigen gelben Doldenstände hervorschießen. Das sind die stattlichsten Formen zwischen Meeresufer und Sumpf, ihnen gesellen sich bald Alcea fici-folia und Lavatera thuringiaca hinzu, die beiden letzteren überdauern die Sommerhitze und Dürre, an der Umbellifere dagegen bricht beim Reifen des Samens der vergilbte Unterbau der Grundblätter zusammen. Einige Kleearten, so namentlich Trif. subterraneum, T. procumbens und agrarium beginnen festeren Rasen bescheidenen Umfanges zu bilden. An den sanften Böschungen solcher Vertiefungen siedelten sich Convolvulus cantabricus, Lotus angustissi-mus und Crucianella stylosa an, zwischen ihnen treten Disteln hervor (Card, seminudus) und in der feuchteren Tiefe der Einsenkung markiren sich dunkelbraunrote Flecken, welche durch Gesellschaften von Eufragia viscosa gebildet wurden. Hier auch werden wir durch zwei stattliche Scrophulariaceen erfreut, von denen die eine, Rhynchocorys Elephas, freilich nur als Seltenheit ausnahmsweise die Höhe des Kaspispiegels {— 86 Fuß) erreicht, während sie eigentlich der subalpinen Wiese angehört, ja sogar bis fast 3050 m (zoooor. F.) heransteigt, und die andere sich Trixago apula nennt.
Die Morzi. Ganz anders sieht Alles landeinwärts von den Dünen aus. Bis nahe zu ihnen treten die Ränder der Morzi, jener Süßwasser, welche durch die vom Meere aufgeworfenen Dünen am freien Abflüsse gehindert werden, die angestaut sind, stagnieren, oder nur einen kaum merkbaren Abfluss zum Kaspi haben. Je nachdem die Ufer derselben flacher oder steiler, nasser oder trockener sind, wechselt die Vegetation an ihnen. Oft beginnt dichter Rohrwald unmittelbar am Ufer, öfter dehnt sich unwegsamer Sumpf hin, dicht bestellt mit Sparganium ramosum, aus welchem Berula angustifolia, Oenanthe fistulosa und O. silaifolia höher treiben. An anderen Stellen steht dichtes Schilf, Typha und Butomus, selten Acorus bauten es auf, es blüht da schon Ende April die nordische Iris Pseud-acorus. Wo der Uferrand zwar flach, aber nicht gar zu nass ist, wachsen die charakteristischen Ranunkeln des Talyscher Tieflandes: R. lomatocarpus, R. ophioglossifolius, und wo das Wasser in Pfützen steht, wuchert der giftige R. sceleratus. An noch anderen Stellen schössen die Juncus- und Cyperus-, seltener Equisetum-Arten aus dem schwarzen Boden hervor. Cyperus longus, Juncus bufonius, J. communis, J. acutus und Eleocharis palustris, auch Carex muricata kann man da finden, und wo das Wasser, wenn auch nur langsamen Abfluss besitzt, steht gewöhnlich am Rande eine schmale Einfassung von Veronica Anagallis. Im Allgemeinen verspätet sich an und in den Morzi die Frühlingsentwickelung der Vegetation sehr, das Wasser und der von ihm durchdrungene Boden bleiben [p.200:] lange kalt, das Rohr z. B. beginnt sich erst zu rühren, wenn auf dem trockenen Festlande weit und breit voller Frühling jauchzt. Dafür vegetieren aber Rohr und Schilf bis tief in den Winter hinein und erreicht namentlich das erstere enorme Höhe und Dichtigkeit, 10—12 Fuß hoher Phragmites bei Zolldicke an der Basis gehört an ungestörten Standorten nicht zu den Seltenheiten. Es werden denn auch hier Phragmites und Arundo Donax schon von der unteren Kura an, wo Mangel an Holz ist, vielfach zu Bauten verwendet. Hier, wo der Wald nahe ist, braucht man das Rohr zu Zäunen und Wandverkleidungen, namentlich bei den Sarais zur Zucht der Seidenraupen. Oft ist die Wasserfläche der Morzi im Sommer total verwachsen, obwohl 2—3 m (7—9 r. F.) Tiefe unter ihr liegen. Das bringt namentlich die Wassernuss, Trapa natans, zu Stande, die sich so dicht mit ihrem schönen Laubwerk über die ruhige Flut baut, dass es schwer hält den Kahn fortzubringen. Die Pflanze liegt an den hakigen Ankern ihrer Früchte, die gelegentlich gegessen werden, im Schlammboden fest. Hier ist sie typische T. natans. albow beschrieb neuerdings aus Kolchis eine neue Trapa Art, die er T, colchica nannte und welche die vermittelnde Form zwischen T. natans und T. bispinosa repräsentirt. Auf freieren Flächen fluten langsam mit dem Wasser Potamogeton pectinatus und Myriophyllum spicatum.
Die Wiesengründe können wir nach ihrer Flora in zwei Kategorien unterbringen. Die einen liegen etwas tiefer, werden im Winter oft überschwemmt und sind dann ungangbar. Auf ihnen kommen zwischen Galium palustre, Rumex pulcher und Sauergräsern etliche Ranunkeln zur Geltung. Außer den gemeinen mit weiter Verbreitung, als R. repens, R. sceleratus und R. muri-catus, auch mehrere die hier entdeckt wurden: R. cicutarius, R. dolosus, R. trachycarpus, R. lomatocarpus und R. ophioglossifolius, von denen die beiden ersteren endemische kaspische Arten sind und die drei letzteren nur einen kleinen Verbreitungskreis in Vorderasien haben.
Kleewiesen. Auf besserem Boden,'der etwas höher gelegen, entwickelt sich streckenweise ein sehr schöner, reiner Kleerasen und zwar ohne Zuthun des Menschen. Trifolium arvense und überwiegend T. tumens bilden solche saftig grünen Plane, die da, wo sie oft betreten werden, wie auf den geräumigen Plätzen vor den Häusern der reichen Mohamedaner, z. B. des Chans von Ta-lysch, ganz niedrig, aber doch üppig bleiben. Die schönen rosa Blütenköpfe von T. tumens schmücken nicht allein solche Fluren, sie duften auch sehr stark honigsüß. Man kann sich kaum lieblichere Plätze im natürlichen Florenschmuck vorstellen.
Die Wälder des Tieflandes. Dem stattlichen Gebäude, einem Ziegelbau orientalischer Architektur, schließt sich im Rücken die imponierende Dekoration des talyscher Urwaldes an. Da bauen die Fiederblätter von hohem Pterocarya-Gebüsch die zierlichen Umrisse im dichten Unterholz, welches vom Dunkelgrün der herzblättrigen Eller (Alnus cordifolia) überragt wird, und vielhundertjährige Quercus castaneifolia oder der unvergleichliche Acer insigne beschatten mit frei entwickelter Krone im weiten Umfang den schwarzen Wald- [p.201:] boden. Für Polygonum Persicaria, Geum urbanum, Geranium Robertianum und Impatiens Noli tangere empfängt er noch Licht genug. Oder es steht weiterhin auf leicht gewellter Oberfläche eine Gruppe uralter Planerabäume, glatt graustämmig, gerade gerichtet, wie jene Eiche 36—42 m hoch; in ihrem Schütze ein kleiner Hain von Buxus sempervirens, dessen Bäumchen 20—25 Fuß hoch sind und die seit Menschengedenken für heilig gehalten, von frommen Scheiten geschont und mit allerlei Lappen und Band behangen werden. Dazu am sonnigen Waldrande die bizarren. Formen hoch-strauchiger Parrotia und ein lieblicher Teppich von Geranium molle und G. lucidum, von Veronica crista galli und V. serpyllifolia, oft auch von Oxalis corniculata, alle auf leichtem, sandigem Boden im Halbschatten. So im Wesentlichen der Hintergrund. Aber vor dem Hause der geräumige, duftende Kleeplan, so glatt, als sei er geschoren. Entlang der Umhegung, in welcher Calystegia die großen, weißen Trichterblumen öffnete, wuchert Sambucus Ebulus, davor blühendes Granatengebüsch oder Hibiscus syriacus, dann ein paar Cypressen, etliche alte Pyramidenpappeln, vereinzelt schirmende Wallnussbäume und ein Durchhau im Pterocaryen-Hochwald, der in weiter Perspektive den Blick ungehindert zum Meere schweifen lässt. Das Alles gewährt die Natur selbst, nur die Cypressen und Pappeln verdanken ihr Dasein der Menschenhand.
Anderweitig eroberten sich gemeinschaftlich zwei kleine Pflänzchen fast ausschließlich die höhergelegenen, trockeneren Wiesengründe. Die eine durchsteppt den Boden förmlich, das ist Senebiera Coronopus, die andere noch winzigere, Polycarpon tetraphyllum var. diphyllum, beide unansehnlich, erheben sich nur wenig vom Boden.
Je mehr wir, in der Uferzone verbleibend, gegen S. wandern, um so kräftiger entwickelt sich der Wald, oft tritt er bis ans Meer, so dass da die hochgehende Brandung den Pterocaryen-Stamm unterwusch und zum Falle brachte. Der Häufigkeit nach herrschen namentlich an allen nasseren Plätzen Pterocarya und Alnus vor. Auch Acer insigne liebt feuchten Standort, aber schon geringe Bodenerhöhung sichert der Eiche, Rüster, Esche und Diospyrus Lotus die Existenz und auf leichtem Boden gedeihen mit Vorliebe Gleditschia und Albizzia, beide endemisch, wild nur dem Südlittoral des Kaspi angehörend. Sie bilden lichte Bestände. Gleditschia trägt gewöhnlich auf verhältnismäßig niedrigem, aber dickem Stamme eine durchsichtig breit ausgelegte Krone, ihr Fiederblatt lässt den Sonnenschein überall durch, zur Blütezeit ist der Gleditschienhain in honigsüßen Duft gehüllt und das Summen der sammelnden Bienen dann von früh bis spät hörbar. Zu dieser Zeit stellen sich Merops-Scharen ein,, um sie einzufangen. Ebenso licht, aber noch viel zarter im Laubwerk baut sich Albizzia auf, doch hoch und schlank im Geäste. Allabendlich und auch bei bedecktem Himmel schläft das Blattwerk ein, nicht so vollkommen, wie bei der Mimose, aber etwa wie bei den Tamarinden, nicht ganz zusammengeklappt. Zur Blütezeit bietet Albizzia eines der schönsten botanischen Charakterbilder dar. Die ungezählten rosafarbenen Filamente mit [p.202:] ihren gelben Antheren hängen, zu dichten Bündeln vereinigt, in abgeplatteten Traubenformen abwärts. Auch diese beiden Bäume verschont das Beil der Bewohner nicht. Gleditschia köpft man, um stachlige Todhecken zu machen; denn die Diagnose LEDEBOUR'S mit dem Charakter »inermis« ist nicht richtig. Der Hauptstamm trägt zwar keine Dornen, wohl aber das jüngene Geäste. Liegt für das Kappen der herrlichen Albizzia-Stämme kein besonderer Grund vor, so verursacht dasselbe jedenfalls einen sehr starken Trieb und diesem ist es zuzuschreiben, dass die entkronten alten Stämme dieser Mimose i m ersten und zweiten Jahre nach der Unthat die täuschend ähnliche Form der tropischen Baumfarne annehmen. So dicht und fein gefiedert hängt dann das leuchtend hellgrüne Blattwerk der jungen Kopftriebe abwärts, dass dem Beschiauer unwillkürlich das Bild ceylonischer oder' javanischer Alsophila-Farne in die Erinnerung tritt. Diese vorderen Partien der talyscher Tieflandswäl der sind gleich denen Gilans und Massenderans, obwohl am ehesten dem Beeile verfallend, streckenweise noch außerordentlich dicht und sehr wild, alber über alle Maßen durch eine geradezu niederträchtige Wirtschaft verrottet und verkommen. Einesteils sind gewisse Gruppen, wo sich in der Rand;zone bei genügender Sonne jene Elemente der Brombeerdickichte noch erhalte:n haben und sich zu diesen nun gleich die kletternden, geradezu mörderisch bewaffneten Smilaxnetze gesellen, in sich abgeschlossen und dem Menschen unzugänglich. Da modert alles Tote und auf den Gräbern der frei faulenden Leichen baut sich neues Leben mit urwaldlicher Kraft üppig wieder auf. Aber andererseits hauste der Mensch in den freieren Waldgebieten auf eine ganz unveiranwort-liche Weise. Riesen, mehrfach hundertjährige, werden gefällt, mannsdicke Äste and alles Kleingezweig bleiben liegen. Spaltet sich der Stamm schwer, so lässt man ihn ebenfalls am Platze ungenutzt verfaulen. Selten seh; äfft man Balkenholz, meistens wird nur Brennholz für Baku geschlagen und zwa.r in der hier üblichen Form, nämlich in geraden 2—2 1/2 m langen, etwa 7—1.2 cm im Durchmesser haltenden Stabhölzern. Eine alte Eiche, die, abgesehen von der Kernfäule, welche fast jede des Tieflandes hat, 15—20 Kubikfaden, also 140—190 cbm guten Brennholzes liefern müsste, ergiebt, nach der hiesigen Manier bearbeitet, 2—3 Kubikfaden = 19—28 cbm; alles übrige von ihr vermodert an Ort und Stelle. Bedenkt man nun, dass außer den vielen Windfällen noch mehr morsches, auf dem Stamm schon durchfaultes Holz im diesen Urwäldern steht, dass an vielen Stellen Sumpf und Lachen existieren, dass in jedem Jahre fast die Bäche aus ihren Ufern treten und weite Gebielte überschwemmen, und vergisst man dabei nicht, dass die NO.- und NW .-Winde diese Waldzone nicht ausfegen, vielmehr, wenn sie draußen toben, hier im Dickichte Alles ruhig bleibt, so wird man begreifen, wie diese Lokalitäten, im Sommer bis zu 20—25° R. erhitzt, die schädlichen Miasmen erzeugen, deren Wirkung sich so deutlich auf den blassen Gesichtern der Gilamer und Talyscher bemerkbar macht.
In ihrer äußeren Gesamterscheinung aber besitzen diese Laubholzwälder des Tieflandes einen fremdartigen, eigentümlichen Typus. Zwar beteiligen [p.203:] sich an dem Aufbau derselben noch sehr wesentlich europäische Arten, indessen greifen doch mehrere dem Kaspi eigene Formen, die ich bereits nannte, so merklich in das Gesamtbild, dass dadurch das summarische Gepräge bedingt wird. Zumal aber sind es die erdrückenden Netze von Smilax excelsa und die fast an jedem Stamme heraufkletternde Rebe, welche zwar an die kolchischen Wälder mahnen, hier aber noch wuchtiger, förmlich erobernd und bis in die höchsten Spitzen der Riesenbäume kletternd auftreten. Überdies fehlt es auch nicht an der schon erwähnten Liane, Periploca graeca, deren spiralig gewundene tauartige Triebe das Opfer, an dem sie hinaufklettern, zum Sterben fest umschlingen und selbst den zähen Smilax gebieterisch bewältigen. Hier wird dieser Schlinger über einen Zoll dick, klettert aber nie sehr hoch. Bisweilen sehen wir das Hochgebüsch am Waldrande von den Guirlanden der Clematis orientalis dekoriert. Im Halbdunkel zu Füßen solcher Partien wuchert Arum Orientale. Besonders bemerkbar in der Randzone macht sich Parrotia persica, das Eisenholz, Temir-agatsch der Tataren, eine dem südlichen Ufer des Kaspi eigentümliche endemische Art. Der hartholzige Baum wächst trotz seiner feuchten Standorte äußerst langsam und bleibt wenigstens im Tieflande nur.in der Höhe des Unterholzes. Sein Geäst verwächst mit einander, wenn es sich berührt. Dasselbe ist glattrindig und wird die Epidermalschicht stellenweise oft abgestoßen; wo sich zwei frische Rindenstellen berühren, wachsen sie dann fest zusammen. Oft geschieht das auch mit den Hauptstämmen. Auf diese Weise bilden sich zwischen dem nicht selten schenkeldicken Geäste unregelmäßig geformte Maschen. Im lichtarmen Hochwalde, höher im Gebirge fand ich den Baum an manchen Stellen als dichten sehr reinen Bestand mit schlanker Stammform.
Es lässt sich die Grenze zwischen dem tiefer landeinwärts stehenden und wenig von Menschenhand beeinflussten Wald und der vorderen Randpartie sehr deutlich erkennen. Jene Grenze hebt sich gleich einer hochstrebenden Kulisse mit ihren bizarren Baumformen von dieser hinteren Waldlandschaft ab. Da, im unberührten Walde stehen die Riesen von Quercus castaneifolia, Zel-kowa crenata, Pterocarya caucasica, Ulmus campestrfs, Carpinus Betulus, seltener der Rotbuche, Eiche, Linde und Acer insigne mit ihrem hier ungestörten Astbau, mehr oder weniger eng geschlossen, oft noch mit den bewaffneten Smilax-Schleiern überwerfen, oder vom üppigsten Epheu bis hoch in die Kronen umrankt, meistens aber als Stütze der verwilderten (oder wahrscheinlich wilden) Weinrebe dienend. Dazwischen hier und da ein toter, morscher, bis an die Spitze verkohlter Stamm von 24—30 m Höhe. Ihm blieb nur das Hauptgerüst seines Skeletts, in welchem der kräftige Schwarzspecht bisweilen eifrig hämmert. Vorn in der Ebene wird man selten einen in seinem Geäste gut entwickelten Stamm sehen. Die leidige Manier, zu köpfen oder seitwärts am Baume die Äste zu schinden, lässt die meisten Bäume sehr schmal und entstellt erscheinen. Das Ganze macht einen ungemein wilden, verrotteten, aber unheimlich großartigen Eindruck. Sind doch diese Gebiete gerade dem Königstiger genehm, der dem [p.204:] Eber nachstellt und, ihm in das Hochrohr der Morzi folgend, zeitweise nur den dichten Urwald und seine Dschungeln in der Randzone verlässt. An feuchten Stellen und namentlich den Gewässern entlang macht sich überall das Unterholz der Pterocaryen geltend, welche, so lange sie als Hochstrauch auftreten, im Bau, Blatt und in der Rindenfarbe sehr an jungen Ailanthus erinnern und überall, in lichten Gruppen verteilt, das Terrain bestehen. Auf trockeneren Plätzen fehlt es nicht an dichtem Crataegus - Gebüsche (C. pentagyna, C. monogyna, C. Oxyacantha), und wenn auch seltener, so findet man doch sowohl Kern- als auch Steinobst in wilden Arten, namentlich Cy-donia, Mespilus und Wildbirnen, sowie Prunus divaricata. Kaum giebt es im Frühjahr in diesen Wäldern ein einigermaßen umfangreiches, trockenes Plätzchen.
Fast jeder Stamm ist bis hoch oben in seinem Geäst mit Moos bewachsen. Vergebens aber suchte ich aus der Lage dieser zusammenhängenden Moospolster auf die Windseiten derselben zu schließen. Es giebt viele Stämme, die ganz in Moos eingehüllt sind,, andere, nahe bei einander stehende zeigten bald die NW. bald die SO. Seiten kahl, so dass man hier von dem Einflüsse des Windes nicht reden kann; denn die Windseiten der Bäume tragen, zumal wenn sie stark exponiert sind, kein Moos. Ebensowenig deutete etwa ein geringes Geneigtsein aller Stämme in einer bestimmten Richtung, oder die einerseits etwas gedrückte Kronenbildung auf vorherrschende Winde, obwohl uns die meteorologischen Beobachtungen für das offene Land darüber belehren, dass NO.- und SO.-, NW.- und SW.-Winde dominieren. Im Hochwalde wird ihre Macht eben. bald total gebrochen. . Außer den Moosen ist es nun namentlich ein Farnkraut, welches hier auf den Stämmen lebt und sich noch in 6—10 m Höhe auf denselben ansiedelte. Das ist Polypodium vulgäre, dessen stumpf umrandete Blattlappen tief eingeschnitten sind und dessen zierliche Wedel abwärts hängend oft ganze Bahnen an den bemoosten und halb hingefallenen Bäumen bezeichnen. Auch Scolopendrium officinarum findet sich hier und da auf den Bäumen, siedelt sich aber lieber zwischen den Wurzeln der Stämme an.
Gebirgswälder. Bei dem Ersteigen des Gebirges bis zur Baumgrenze lernen wir die Höhengrenzen für etliche Baumarten kennen. Wählt man dazu das Grenzthal der Astara als das russisch südlichst gelegene, so verbleiben die charakteristischen Bäume des Tieflandes noch einige Zeit, andere fehlen sehr bald. Zu diesen letzteren gehört Gleditschia und die Granate, beiden
[Tafel?] Erklärung der Tafel. Die Photographie wurde von winogradow-nikitin im Juli 1896 nahe bei der Baumgrenze gemacht. Quercus macranthera F. et M. in ca. 1800 m (6000 r. F.) im Trialeth-Gebirge (Borshom) als Einzelbaum nahe der Baumgrenze in üppiger subalpiner Kräuterwiese, bis jetzt nur aus dem Antikaukasus von seinem centralen Teile ostwärts über das Gandsha-Gebirge nach Karabagh und in den subalpinen Randzonen der nördlichen Abhänge des Alburs-Systems (Talysch, Gilan, Massenderan) bekannt. Oft als mächtiger, isoliert vorgeschobener Hochstamm bis über 2280 m ohne Vermittelnng von Knieholz in die subalpine Zone tretend.
[p.205:] ist der Urwald zu schattig. Rüstern, Weißbuchen und Eichen bilden auf dem Gebirgsfuße fast ausschließlich die kompakten Bestände. Die individuelle Entwickelung derselben ist durchschnittlich sehr kräftig, die Stämme sind gerade, weit hinauf astlos, die Kronen seitlich beengt, weil der Wald zu dicht steht. An weniger beschatteten Stellen gedeiht auch im Gebirge Albizzia und zwar bis 750 m Meereshöhe. Der Baum besamt sich freiwillig, viel kräftiger Nachwuchs, zum Teil nur einige Jahre alt, beweist das. Stämme von 60 Fuß Höhe bei Leibesdicke sind nicht häufig. Pterocarya folgt dem Wasser; hier sowohl, wie in Kolchis steigt sie ihm entlang wohl nur selten über 300 m Meereshöhe hinauf. Dieser Höhe entspricht auch ihr Vorkommen an der Südseite des centralen Kaukasus, nämlich im unteren Alasanthale. Auf den Intervallen, also vom Alasan einerseits bis zum unteren Rion, andererseits bis zum Tief lande von Talysch, d. h. auf Strecken von ca. 500 und 600 km fehlt diese Juglandee. Auch sei bemerkt, dass einige der charakteristischen Bäume dem NW.-Fuße des Alburs, da wo er sich in die Mugan senkt, entweder ganz fehlen oder doch nur selten angetroffen werden. Zu solchen gehört auch Albizzia und Gleditschia, dort dominiert bis zu 1200 m namentlich an den Ostgehängen des Gebirges Quercus castaneifolia, nicht schlank und hoch wie im Tief lande, sondern mit untersetztem, knorrigem Habitus. Mit zunehmender Höhe tritt nach und nach die Rotbuche in ihre Rechte als herrschender Baum.
Doch folgen wir nach diesen Bemerkungen wieder dem Astarathale aufwärts. Hochstämmiger Diospyros und Parrotia steigen dort bis zu 1050 m heran. Auch Acer insigne und die Feige, letztere mit Stämmen von Schenkeldicke, wurden noch in 900m notiert. Im geschlossenen Hochwalde erhebt, sich Parrotia als schlanker Stamm von 40—50 Fuß Höhe, dessen Geäste nicht zu großlöcherigen Maschen verwächst. Rotbuche und Linde sind in der unteren Laubwaldzone nur vereinzelt anzutreffen, die letztere bildet überhaupt keine größeren Bestände. Je höher man steigt, um so häufiger wird Fagus, die Gürtelbreite, in der sie oft ganz rein als Hochwald steht, mag sicherlich 900 m betragen. Einzelne Individuen treten abwärts auch hier bis zum Meere. Aber nach oben bildet sie, wie im Kleinen Kaukasus, so auch hier in Gemeinschaft mit Rüster und Wildbirne die Baumgrenze in 1830—2000 m. Nur Quercus macranthera in Stammesdicken von 2 ½ Fuß tritt samt Pirus communis noch höher auf 2130 m und merkwürdiger Weise stehen beide nur als weit vortretende Einzelstämme ohne irgend welches Unterholz oder Buschwerk in der subalpinen Wiese.
In den geschlossenen Hochwäldern ist die Bodenflora arm, Mangel an Licht und Sonne bedingen das. Die Armut nimmt in den reinen Buchenbeständen noch zu. Mit 3—4 Rubiaceen (Galium cruciata, G. articulatum, G. parisiense) höher auch der Waldmeister, Asperula odorata, Stachys silvatica, Brunella vulgaris, Orobus hirsutus, O. aurantius, Sanicula europaea, Hypericum scabrum, Stellaria media, Circaea lutetiana, endlich Viola canina [p.206:] var. silvestris und Primula veris, die beide schon reife Kapseln hatiten (25. Juni), ziemlich viele Erdbeeren und ab und zu eine Gruppe hoher Calamagrostis und Milium - Gräser (C. silvatica, M. effusum) oder an andeiren Stellen ein Massiv von Tollkirschen, mit allen diesen wären wohl die vornehmlichsten Pflanzen solcher Waldgebiete erschöpfend namhaft gemacht. Höher im schattenreichen Buchenwalde sieht es noch ärmlicher aus, blasse Neottia- und Lathraeagruppen entdrängen sich da dem Boden, machen das dicke Dach trockenen zimmetbraunen Laubes bersten, wenn sie hervortreiben, oder es stehen vereinzelt die beiden Cephalantheren (C. pallens, C. ensifolia) am Abhänge des Gebirges in flacher Einsattelung, wo sie das Sonnenlicht niemals trifft. Wo der Wald sehr schattig ist, fehlt das Unterholz vollständig, zumal in den höher gelegenen Rotbuchenbeständen. Hier sieht man nicht selten 8—10 der mächtigsten Fagusstämme aus einer Wurzel in gigantischer Buschform aufstreben. In solchen Fällen haben die einzelnen Stämme doch noch bis 2 Fuß Durchmesser über der gemeinschaftlichen Wurzel, sie neigen sich von einander ab und erst in 30—40 Fuß Höhe vom Boden beginnt iihre Verästelung.
Die Hochebene von Ardebil. Nur wenige Worte will ich über die waldlosen Strecken bis zum S'awalan sagen. Die Materialien aus der subalpinen Zone, von der Ebene Ardebils und aus der hochalpinen des S'awallans verwerte ich in dem betreffenden Spezialabschnitte. Hier sei nur gesagt, ciass Papaver Orientale die subalpinen Wiesen an der russisch-persischen Gre:nze schmückt, dass solche Wiesen aber nur an schwer zugänglichen Gehängen sich ausbilden können. Überall wo das Terrain keine oder geringe Schwierigkeiten darbietet, wird es alljährlich so stark beweidet, dass sich der Raisen nur ganz kurz und sehr fest herausbildet. Die Ebene von Ardebil (13710 m) ist an vielen Stellen schwach salzig. Obione verrucifera, Firan-kenia hirsuta und Iris Guldenstädtiana var. livescens beweisen das. Von Ardebil selbst ist noch zu melden, dass die Rebe ausnahmsweise gepflegt wird und hier bei winterlicher Deckung gedeiht. 2 bis 4 Zoll (5—10 cm) ducke Stöcke, unbeschnitten, waren Ende Juni erst im Triebe, man vernachlässigte sie in den letzten Jahren, sie hatten vom Frost gelitten.
Schlussfolgerungen. Die Schlussfolgerungen, welche ich bei der Beendigung dieses Abschnittes machen darf, lauten:
1. Am südlichen Kaspiufer, entlang den Steilabsenkungen des Albmrs-stockes, werden im schroffen Gegensatze zu den West- und Ostufern des Binnenmeeres die vorteilhaftesten klimatischen Bedingungen für die Vegetation dargeboten.
2. Es hat sich da eine Flora erhalten und ausgebildet, welche in vieler Beziehung der kolchischen gleichkommt und die wie jene in manchen Airten als Rest der Vegetation zu Ende der Tertiärzeit betrachtet werden kann.
3. Der vollständige Mangel an zapfentragenden Nadelhölzern unterscheidet die Flora von Talysch wesentlich von der des östlichen Pontus-ufers. Auch die 6 kaukasischen Juniperus-Arten sind fast ganz verschwunden. [p.207:] Sicher nachgewiesen wurden nur J. communis und J. Sabina. Taxus ist vorhanden.
4. Ohne Zweifel bieten die trockeneren Plätze am Südufer des Kaspi gleich vorteilhafte Bedingungen für das Gedeihen subtropischer Pflanzenarten und mancher Palmen, wie das süd- und nordöstliche Gestade des Pontus. Es fehlt, um das zu beweisen, nur an rationellen Versuchen. Das Gedeihen (seit etwa 45 Jahren) einer Dattelpalme auf der Insel Aschurade — wenn auch nicht stammbildend — liefert für das Gesagte bis jetzt den einzigen Beweis.
5. Gleich den Coniferen fehlen auch die Rhododendron-Arten vollständig. Von Vaccinium ist nur V. Arctostaphylos nachgewiesen. Philadelphus coro-naiius und Lonicera Caprifolium führt für das russische Talysch Niemand an, ebenso wurde nirgends Nuphar, Nymphaea und Nelumbium gefunden, obwohl an stehenden Gewässern großer Ausdehnung Überfluss ist. Man kennt auch keinen Helleborus aus unserem Gebiet. Clematis Vitalba wird durch die ver-waidte C. orientalis, Scilla cernua durch die endemische S. Hohenackeri ersetst. Von den 10 Holzarten, die nur im Südkaspi-Gebiete gefunden wurden, sini 5 endemisch, 5 haben nur einen kleinen Verbreitungskreis.
|
4. Die kauk. Wälder |
|
I. Allgemeines |