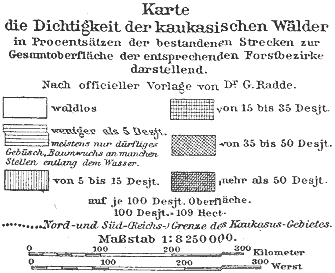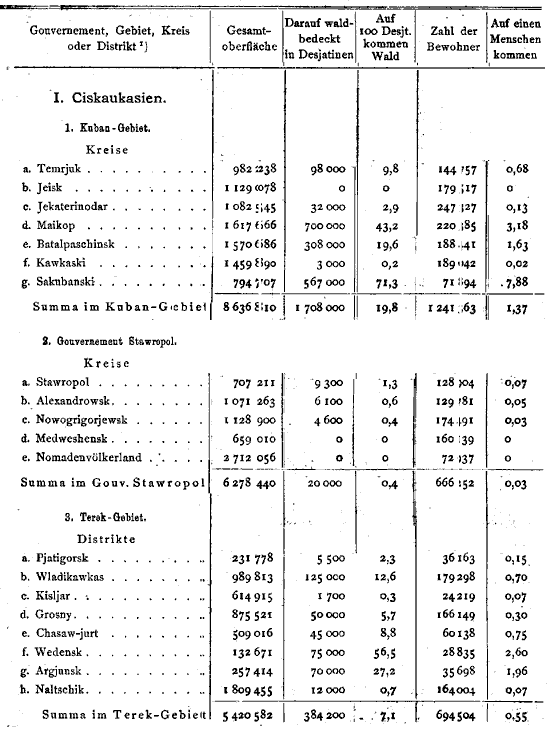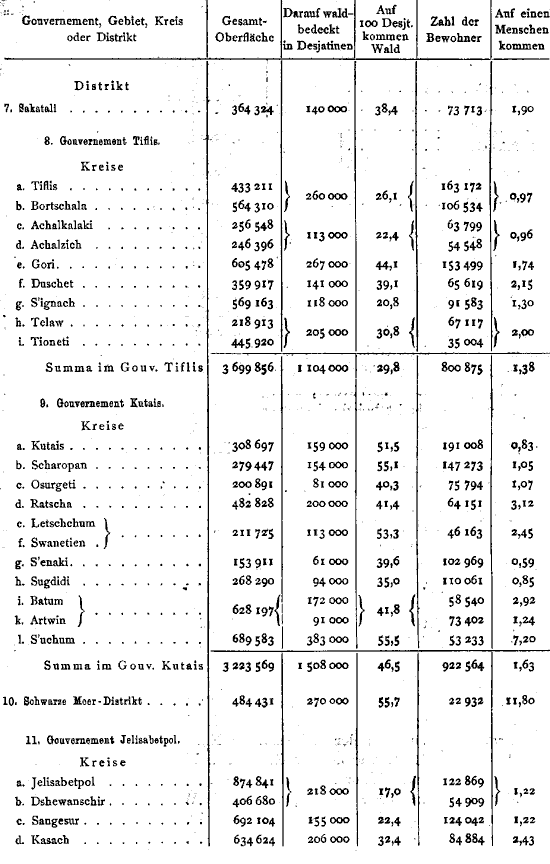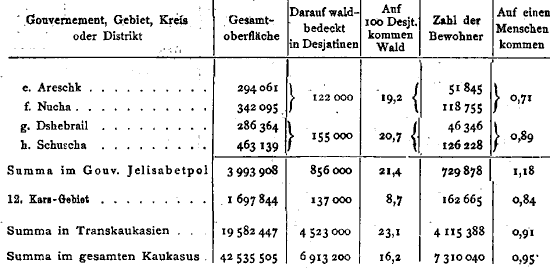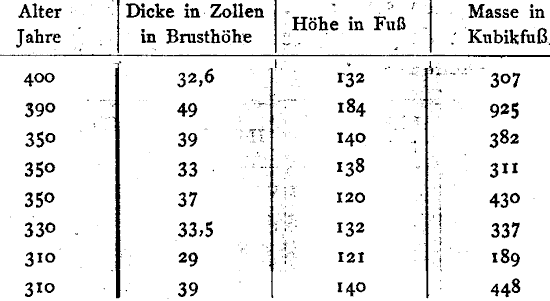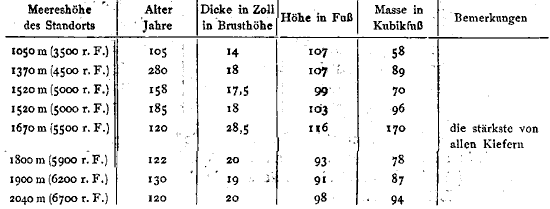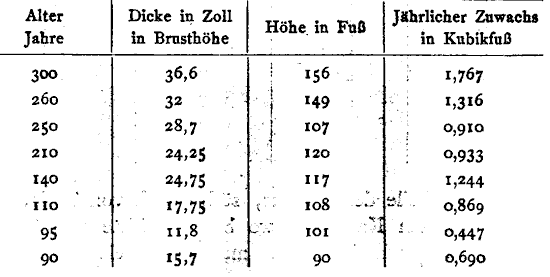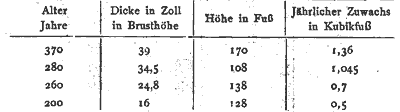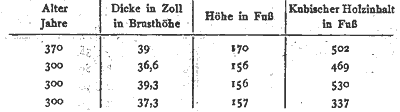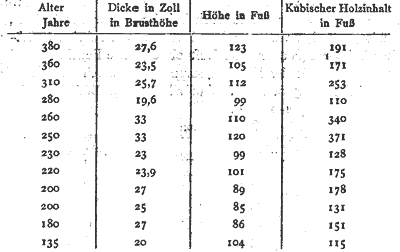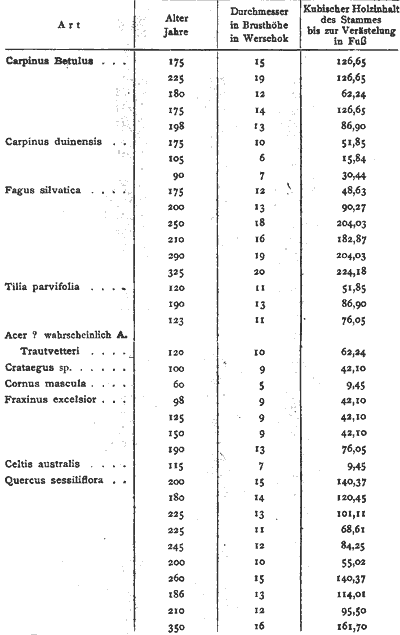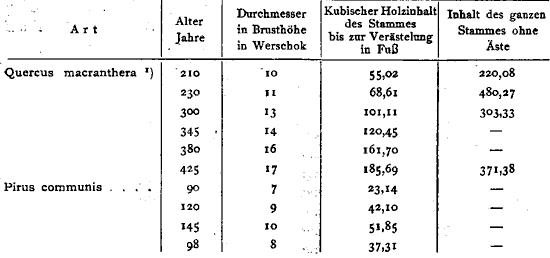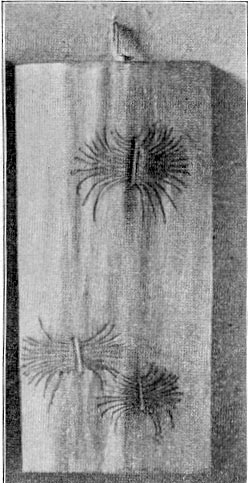[Radde,
Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländern]
Kapitel 4 Abs. 1.
Viertes
Kapitel,. Die kaukasischen Wälder.
Verteilung
der Wälder über das ganze Gebiet
S. 207. Tabelle über Verbreitung und Dichtigkeit
der Wälder und über das Maß auf die Kopfzahl der
Bevölkerung in den Kaukasusländern S. 213. Die
Qualität der Wälder, Pflege derselben und Misswirtschaft
S. 216. Maßangaben über die wichtigsten
Holzarten S. 221. Die
Wälder der Domäne Borshom in wirtschaftlicher Hinsicht
S. 226. Schädliche Insekten der kaukasischen,
speziell der Borshomer Wälder S. 230.
Wir
haben in den vorangegangenen Kapiteln für die Kaukasusländer
die Extreme der Vegetation kennen gelernt, nämlich die Steppen
ohne eine Spur von Wald und die beiden waldreichsten Gebiete im W.
und SO. des Isthmus an den beiden Grenzmeeren, — in Kolchis und
Talysch, — ohne eine Spur von Steppen. Nunmehr gilt es, über
den Wald im allgemeinen das Nötige zu sagen und daran einige
Schilderungen über Wälder zu schließen, welche
außerhalb jener bereits besprochenen üppigsten Waldgebiete
liegen.
Verteilung
der Wälder über das ganze Gebiet. Wenn wir hoch aus der
Vogelschau von N. nach S. zwischen den Meridianen des Kaspi und
Pontus den Blick über den Isthmus schweifen lassen, so wird er
im Süden vom Don zunächst das weite Gebiet der kahlen,
waldlosen Steppen erfassen, wo den beiden Rinnsalen des Manytsch
folgend westwärts nur hier und da sesähafte Menschen einige
Weiden pflanzten, ostwärts auch diese fehlen. Lange noch sucht
das Auge vergebens nach kompakteren Baum- oder Strauchgruppen, ers:
unter der 45. Breite, ziemlich in der Mitte zwischen beiden Meeren
und wenig westlich vom 60. Meridian von Ferro treten inselartig auf
der hier über [p.208:] 600 m (2000 r. F.) hohen Ebene die
Wäldchen von Stawropol auf. Liegen diese uns im Rücken, so
folgen beiderseits von der Scheide zwischen Kuban und Terek den
Wasserspiegeln dieser Ströme und ihrer südlichen, vom
Gebirge kommenden Zuflüsse mehr oder weniger breite, oft
unterbrochene grüngraue Streifen und Bänder. Es sind die
Pappeln und Weiden der Niederungen, von der Natur schon gegeben, vom
Menschen ergänzt und im besten Falle zu kleinen »Auenwäldchen«
entlang den Ufern herangezogen. Von nun an tritt uns die Nordseite
des riesigen Kettengebirges immer deutlicher entgegen und von NW.
gegen SO. können wir seinen Fuß verfolgen, nachdem die
inselartig hoch aus der Steppe hervortretende Gruppe des Beschtau
sich etwas nördlich vom 44. Breitengrade und im Meridiane von
60° 45' als bewaldet erwiesen. Beginnend im äußersten
Westen bei Anapa und entlang der Nordseite des Gebirges, deckt bis
zum äußersten Osten bei Petrowsk eine in Breite und
Dichtigkeit wechselnde Waldzone den gewaltigen Körper des
Kaukasus. Wo er seinen breiten Fuß unmittelbar in die Steppe
setzte, wird das Waldesgrün lichter und zerstreut sich nicht
selten als Busch weit vorwärts in die Ebene. Vollgedeckt und
zwar in den tieferen Lagen ausschließlich mit Laubhölzern
erscheint das Mittelgebirge; nur im centralen Teile, zwischen Kasbek
und Elbrus, wo die Terekquellen gelegen, werden sie stellenweise
lichter und fehlen anderweitig ganz. Dann wieder erscheint unseren
Augen, gleich östlich von Wladikawkas in der Tschetschna das
reine Grün der Eiche und höher das dunklere der
geschlossenen Buchenwälder; gleichzeitig mit dem kalkigen Fuße
des Daghestan treten sie weit gegen Norden vor, jetzt bis zur Sunsha,
ehedem an manchen Stellen bis zum Terek. Aber wenn wir dort im
Westen, schon vom Fischt und Oschten an, 'oben an der Grenze der
lichtgrünen Laubhölzer vielfach eingekeilt und angerandet
die dunkeln Farbentöne der Coniferen bemerken, so fehlen diese
hier im Osten gänzlich. Immer dürftiger dem Kaspi entgegen
wird der Baumwuchs. In der Ebene folgt er wieder den Flussläufen
oder macht sich zwischen den S'ulak und Terek in oasenartigen Flecken
kenntlich. Ein Paar solcher grünen Tupfen erblicken wir, wie
früher im oberen Teile des Wolgadeltas, so jetzt hier in dem des
Terek. Im Gebirge, zumal im östlichen Daghestan, erscheinen uns
große Strecken ganz kahl, weiß (Kalk), graubraun
(Schiefer). Selbst oberhalb der berühmten Wälder von
Itschkerien, aus deren Dickichten im Hinterhalte die Krieger Schamyls
s. Z. den Russen große Verluste beibrachten, sind Andien und
Awarien, sowie auch der Gunib-Gau nur schwach, weiter gegen Süden
Kasi-Kumysch und der Mittellauf des S'amur nur ganz gering sporadisch
bewaldet. Besser gestaltet sich das dem Meere entlang auf den Anhöhen
zwischen den beiden östlichen Endpunkten des Kaukasus, zwischen
Petrowsk via Derbent nach Apscheron hin. Die Halbinsel selbst mit
Baku und dem gesamten Naphta-Gebiete liegen freilich abschreckend
kahl da. Dieses äußerste SO.-Ende des Kaukasus bildet in
Bezug auf seine Holzgewächse ein ebenbürtiges Äquivalent
zum NW.-Anfange des Gebirges, denn auch das Vis-ä-vis von
Kertsch, die Halbinsel Taman, trägt weder Strauch noch Baum.
Aber [p.209:] am östlichen Ende treten uns schon auf dem Wege
nach Kuba und ebenso auf den Höhen im Rücken von Derbent
größere Waldkomplexe, immer aber nur von schwachem Wüchse
entgegen. Sie erreichen, mehr oder weniger insular getrennt, das
Krüppelgesträuch der Eichen auf dem Tik-tübe bei
Pe-trowsk.
Wir
müssen das Auge höher heben, um die transkaukasischen Gaue
und das armenische Hochland zu überschauen. Möge es
zunächst auf den Eis-und Firnfeldern der Kammzone ruhen und am
Fischt und Oschten beginnend über Elbrus und Kasbek, über
Baschlam und Bogos fort bis zum Schah-dagh ausschweifen. Selbst ein
so flüchtiger Blick wird genügen, um zu konstatieren, dass
von NW. gegen SO. die Schneelinie höher Und höher steigt
und dass an den extremen Enden der Unterschied reichlich 600 m (2000
r. F.) beträgt.
Der
Überblick der Südseite des Kaukasus und des ihm südlich
gegenüberliegenden pontischen, adsharo-imeretischen und
armenischen Randgebirges gewährt uns in Bezug auf den Wald ein
ganz anderes Bild, als wir es bis dahin vor Augen hatten. Wenn auch,
wiederum von Anapa beginnend, bis Tuapse die Unterschiede zwischen N.
und S. sich fast ausgleichen, so beginnt dann weiter dem Pontusufer
entlang, die äußersten Rionquellen umfassend, ein fest
abgeschlossenes Waldgebiet, dessen eingehende Schilderung ich bereits
oben gab.
Ostwärts
vom Meskischen Meridianscheider zwischen Kura und Rion tragen zwar
ebensowohl die Südfronten des Großen Kaukasus, als auch
die Nordseiten seiner Contreforts — der sogenannte Kleine
Kaukasus oder, besser gesagt, das Randgebirge Hocharmeniens, —
geschlossenen Wald, aber je näher wir auch hier zum Kaspi
blicken, um so lichter wird er und auch die individuelle Kraft des
Wachstums schwindet mehr und mehr. In breiter Keilform drängt
sich von Osten her bis in das Herz des Landes das Kurathal,
allmählich bis oberhalb von Tiflis zu 480 m (1600 r. F.)
ansteigend und in seiner Steppenflora, wie wir schon sahen, alle
Varianten der nördlichen Steppen aufweisend. Beide Seiten des
Kurathales tragen Wald. Wir sehen zunächst, hoch von oben
blickend, links und rechts, da wo der Fluss das armenische Hochland
bei Ardagan verlasst und sich in enger Schlucht den Weg zur S'uram
Ebene gegen NO. und O. bahnte, beide Gehänge von stattlichstem
Hochwald, in welchem die Nadelhölzer dominieren, bestanden. In
ihrem direkten Anschlüsse an die adsharo-imeretischen Gebiete
haben sie noch ganz die Kraft jener schon mehrfach erwähnten
Wälder. Nach Süden hin werden sie alle scharf in Höhen
von ca. 2000 m (6—7000 r. F.) abgeschnitten und gelangen nicht
auf das kahle armenische Hochland. Die Kiefer, Acer Trautvetteri, die
Weißbirke, seltener hier schon die Rotbuche ziehen die
Baumgrenze. Aber weiter westlicher, im nördlichen Taurus-System,
welches die Tschoroch-Wasser von denen der Kura, des Araxes und
Euphrat (Muradtschai) trennt, lebt die Kiefer in reinen
Massenbeständen und zwar in Höhen von 2130—2750111
(7—9000 r.F.). Das sind große, fast schwarze Flecken, die
unserem Auge um so mehr auffallen, als rundherum, weithin, auf dem
armenischen Hochlande der Wald fehlt und [p.:210] selbst
elendes Gebüsch nur an wenigen Plätzen zu finden ist. Die
Spiegel der Alpenseen, welche in Höhen von 1920—1980 m
(6300—6500 r. F.) gelegen, glänzen uns aus üppig
subalpiner Wiese entgegen auf dem ganzen Plateau, welches von Kars
über Ardagan und Achalkalaki zum Trialetrande der mittleren Kura
strebt und von da gegen SO. in gleicher Höhe über den
Goktschai-See fort sich an den Karabag'her Meridianstock lehnt. Wie
in jenen Tiefsteppen, die wir von der unteren Wolga über die
Minimalwasserscheide der Manytschhöhe nach Süden, nach W.
und O. verfolgten, kein Wald im eigentlichen Sinne des Wortes zu
finden ist, so auch hier auf dem hohen Rücken Armeniens.
Schüchterne Versuche zur Waldbildung macht hier und da die
Eiche. Geringen Buschwald von ihr sehen wir westlich vom Goktschai
und noch geringeren am SO.-Fuße des Alagös, andere im
Daralagös-Gau. In der Einsattelung zwischen beiden Araraten
deutet ein kleiner grüner Flecken das höchststehende
Birkenwäldchen an, aber in der Höhe von fast 2440 m (8000
r. F.) war der Wuchs nur sehr langsam (ich zähle an 75 mm dicken
Stammproben 45 Jahresringe) und die schweren winterlichen
Schneedecken ließen den Stamm nicht hoch gedeihen, sie drückten
vielmehr den Hochbusch breit auseinander.
Kürzer,
aber durchaus in demselben Typus schneidet der Schwesterfluss der
Kura, der Araxes gegen SW. in das Land. Zuerst unbehindert in der
Ebene mit flachen Ufern, oft austretend und sein Bett ergänzend,
dann höher beengt und endlich, vom Ostende seiner mittleren
Stufe an, in schmaler Engschlucht förmlich verriegelt.
Linkerseits durch die südlichen Steilabstürze der Gebirge
Karabaghs, rechterseits durch die des persischen Karadagh
eingezwängt. Der hochgelegene Karabaghgau ist vielerorts von
verrotteten minderwertigen Laubwäldern bestanden, ebenso die
Gehänge seines nach W. scheidenden hohen Gebirges, welches
Gipfelhöhen bis über 3660 m (12000 r. F.) (Kapudshich)
be1-sitzt. An diese Waldpartien schließen sich dann die im S.
des Goktschai am östlichen Arpatschai im sogenannten
Daralagösgau.
Ich
will schließlich noch einige ergänzende Worte zunächst
über das Verschwinden der Coniferen in Transkaukasien sagen.
Wiederum ist wie an der N.-Seite des Gebirges so auch weiter südwärts
dieses Verschwinden der Coniferen sehr auffällig. Zuerst
erreicht die Nordmanntanne im Kl. Kaukasus an den Quellen der Algetka
(62. Merid.), davon wenig östlicher — fast im Meridian von
Tiflis im oberen Aragwathale bei Passanaur (62° 30') — die
kaukasische
[p.:211]
(Karte)
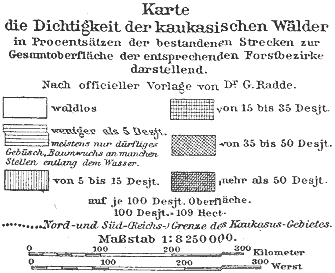
Erklärung
zur Karte Fig. 5. Die Dichtigkeit der Schraffierlinien richtet sich
nach dem Procentsatze in Desjatinen der Waldflächen znr gesamten
Oberfläche des betreffenden Forstbezirks. Umfasst ein solcher
Forstbezirk eine große waldlose Steppenfläche, während
im Gebirge auf den höheren Lagen gute Wälder stehen, so
ergiebt sich dennoch für den gesamten großen Bezirk nur
ein geringer Procentsatz von Wald und somit auch nur eine lichte
Schraffierung für ihn. Es fällt das namentlich in dem
Forstbezirk von Naltschick sehr auf, der im Quellgebirge des Terek
zwar gute Wälder besitzt, sich aber weithin in die waldlose
Steppe erstreckt, und welchem man deshalb die lichteste Schraffierung
geben musste. Wie wir aus den Tabellen wissen, deckt das Gebiet von
Naltschick eine Fläche von 1809455 Desj. Davon sind nur 12000
Desjt. waldtragend.
[p.:212]
Fichte ihre Grenze gegen Osten. Im Großen Kaukasus wurde
Abies Nordmanniana noch am oberen Liachwalauf (bei dem Dorfe Dshawa),
also nicht bis zum 62. Meridian nachgewiesen. Die Kiefer,
welche an der N.-Seite des Großen Kaukasus bis fast zum Ende
des Gebirges, wenn auch meistens nur krüppelig, wächst, z.
B. noch oben im östlichen Daghestan und unten bei Tschir-jurt,
kommt an der S.-Seite bei weitem nicht so weit gegen Osten vor. Aus
dem Lande der Chefsuren im Centralteile kenne ich sie noch, aber an
den Alasanquellen verschwindet sie. Die ganze .steile Südwand,
etwa vom 63° 30' beginnend über Sakatali, Nucha und
Schemacha fort, besitzt keine zapfentragenden Coniferen [Anm.#1:
Unten auf der Eldar-Terrasse: P. maritima Lamb. = P. halepensis
Mill.]. Auch im Kleinen Kaukasus erreicht P. silvestris kaum
den 64. Meridian, denn der bis jetzt ermittelte östlichste
Standort von ihr liegt südlich von Jelisabetpol am
Kürück-tschai-Bache und schon im viel westlicheren Thale
der Akstafa kommt sie nur selten und in kleinen Gruppen oberhalb von
Delishan in 1280 m (4200 r. F.) Höhe vor [Anm.#2:Man
vergleiche die Karte; auf ihr sind die Längen nach dem Meridian
von Paris angegeben, im Text nach dem von Ferro (Differenz 20°).].
Nur
einmal noch kommt der Wald im Gebiete der mittleren Kura zur
strotzenden Üppigkeit und individuellen Kraftentwickelung wie in
Kolchis und Talysch, nämlich im Alasanthale. Je weiter von da
nach Osten, um so mehr verarmt er. Schon von Schemacha an ist
das Ende des Großen Kaukasus fast überall kahl. Dieselbe
Verarmung gegen Osten gilt auch von den Gandsha- und Karabaghwäldern,
die kaum irgendwo den Charakter von vollgültigem Urwalde
besitzen und überdies noch, wo nur irgend zugänglich, seit
Menschengedenken misshandelt werden. Vor ihnen in der Tiefe, dort im
breiten Kurathal, hier auf den letzten Auswallungen des Gebirges in
die östliche Mugan, giebt es Buschholz mit viel Paliurus und den
Flüssen entlang überall mehr oder weniger breite
Auenwäldchen, in denen Schwarz- und Silberpappeln neben
Maulbeeren und Rüstern die Hauptrolle spielen, die aber auch
nach Osten hin an Umfang und Stärke abnehmen und mit der
Vereinigung des Araxes und der Kura ganz aufhören.
Erst
wenn wir vom Ostfuße Karabaghs in die Einöde der Mugan
treten und diese über den Araxes fort gegen SO. durchwandern,
beginnt mit dem Alburssystem ein mächtiger Wechsel in den
physikalischen Grundzügen der Natur, der in den geschlossenen
Urwäldern von Talysch, Gilan und Massen-deran zum klarsten
Ausdrucke kommt.
Wir
haben im Vorstehenden zwar, so hoffe ich, ein übersichtliches
Bild von der Verbreitung der Wälder im Kaukasus erhalten, auch
ungefähr erfahren, wo die besten und dichtesten Wälder
stehen, aber genauere Auskunft über den Flächenraum, den
sie bedecken, und über den Procentsatz, den sie diesem gegenüber
repräsentieren, soll zunächst die Tabelle geben, welche ich
hier folgen lasse. Dann wollen wir, wie es schon im pontischen
Ufergebirge geschah , einige größere Exkursionen in die
Wälder machen und dabei die gesamte Vegetation in ihnen kennen
lernen. [p.:213]
Tabelle über
Verbreitung und Dichtigkeit der Wälder und über das Maß
auf die Kopfzahl der Bevölkerung in den Kaukasusländern ,
nach den neuesten offiziellen Angaben.
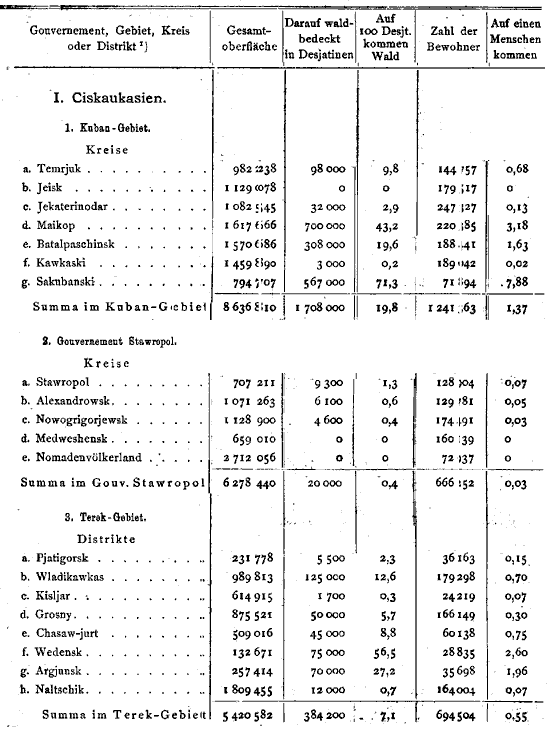
1)
Oblast entspricht dem deutschen Wort Gebiet und Okrug heißt
Distrikt.
[p.:214]

1)
Unbegreiflicherweise wird in den offiziellen Schriftstücken und
auf den Karten der Daghestan zu Transkaukasien gezählt, während
er doch an der Nordseite des Gebirges gelegen ist; das hat also nur
eine administrative Bedeutung.
2)
In der zweiten Rubrik für das Daghestan-Gebiet ist die Addition
im Original nicht richtig. Ich korrigiere nach den mir vorliegenden
Ziffern.
[p.:215]
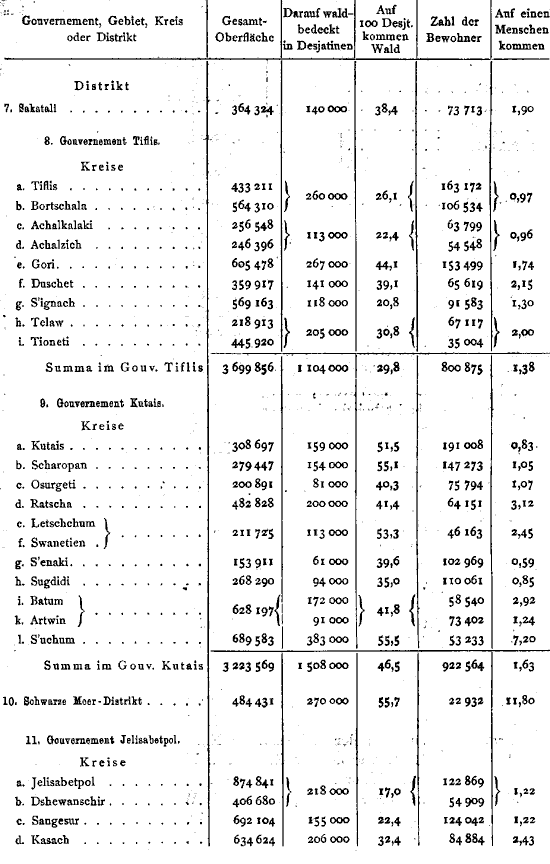
[p.:216]
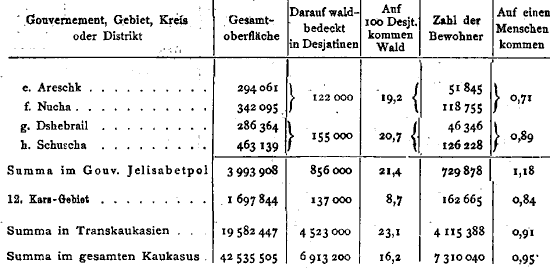
Wir
konnten uns über die Verteilung des Waldes in den
Kaukasusländern nach den gemachten Mitteilungen und der Karte
eine klare Vorstellung machen. Auch wissen wir aus den früheren
Tabellen, welche Holzgewächse überhaupt auf unserem Gebiete
vorkommen, aber über die Qualität der kaukasischen Wälder
habe ich noch nichts Ausführliches gesagt, das soll jetzt
geschehen.
Die
Qualität der Wälder, Pflege derselben und Misswirtschaft.
Der Begriff »Wald« ist bei der Bevölkerung ein sehr
weiter. Auch das Gebüsch von einigermaßen größerem
Umfange bezeichnet der Steppenbewohner als Wald. Wer nach den
Erzählungen der Leute sich über den Wald eines gewissen
Gebietes eine Vorstellung im voraus macht, wird, wenn er mit eigenen
Augen sieht, oft enttäuscht. So z. B. auch bei Tschir-jurt,
worüber ich schon sprach (pag. 212). An den leicht zugänglichen
Plätzen hat man im Kaukasus überall mit dem Hochwalde
aufgeräumt. Entlang dem ganzen Nordfuße des Gebirges von
Anapa an bis zum Tik-tübe hat sich die Eiche als
zusammenhängendes Gebüsch am weitesten gegen N. in der
Steppe erhalten, ihr schließen sich Schlehen (Pr. spinosa) und
Rhamnus Pallasii (= Rh. erythroxylon) und ausgedehnte Paliurus-Maquis
an. Den ehemaligen Hochwald, der da sicherlich stand, wo man jetzt
nur Gestrüpp und die Maquis sieht, haute man aus. Es geschah das
oft absichtlich und im großen Maßstabe, z. B. noch vor
40—50 Jahren zur Zeit der Schamyl'schen Kriege in der
Tschetschna, um das Terrain klar zu machen. Auch ohne eine solche
exceptionelle Nötigung fand es von jeher bis auf den heutigen
Tag bei den gewöhnlichen Wirtschaftsverhältnissen in
rücksichtslosester Weise statt. Man hat hier keine Pietät
weder für den Wald, noch überhaupt für den Reichtum
der Natur (Fischerei, Jagd). Raubwirtschaft überall trotz
vorzüglicher Gesetze, welche, wenn befolgt, der oft schon sehr
erschöpften Natur aufhelfen könnten.
Mancherlei
Übelstände sind es, welche die Waldpflege nicht allein
erschweren, sondern sie überhaupt für größere
Gebiete unmöglich machen. Von Hause aus ist der Begriff »Forst«,
d. h. der gereinigte, gepflegte und regel- [p.:217]
recht bewirtschaftete Wald, für die Kaukasusländer
ausgeschlossen. Ebenso dürfen wir das Wort »aufforsten«
für unser Gebiet kaum gebrauchen. Ich kenne nur einige kleine
Wälder, oder Plätze geringen Umfanges in ihnen, die im
Privatbesitze sind, und in denen die Eigentümer ihren Wald
pflegen, da sieht man die erfreulichsten Resultate. So war z. B. in
dem Auenwald, linkerseits entlang der Kura, 40 km abwärts von
Tiflis (Karagas, der großfürstliche Sauenstand) vor 30
Jahren, als er noch von der umwohnenden tatarischen Bevölkerung
ganz nach Belieben misshandelt wurde, in einem schrecklichen
Zustande. Die über das ganze Land, zumal bei der
Nomaden-Bevölkerung verbreitete Unsitte des Kronenschindens
(Kopfverhackens) hatte natürlich auch die starken Eichen des
Karagas nicht verschont. Meterdicke Stämme trugen ganz geringe,
verkümmerte Kronen. Nachdem der Großfürst Michail
Niko-lajewitsch diesen Besitz sich als Jagdgebiet gesichert und ihn
bewachen ließ, haben auch die ältesten Eichen im Verlaufe
von 30 Jahren prächtige Kronen mit oft schenkeldickem Geäste
aufgesetzt.
Ein
zweites Beispiel von löblicher Waldpflege liegt mir aus dem
Gandsha-Gebirge vor. Auf der Kupferhütte der Gebrüder
Siemens, Kedabeg (1235 m = 4050 r. F.) hat man die nächstliegenden
Wälder gereinigt, genügend gelichtet und in Schläge
eingeteilt. Auch hier that und thut die Natur vollauf ihre
Schuldigkeit, es ist eine wahre Freude zu sehen, wie das geförderte
Wachstum bei einiger Schonung und Nachhülfe die alten Schäden
bald ganz beseitigt. Hier bemühte man sich auch Coniferen
aufzuforsten. Der Erfolg blieb aus. Mag sein, dass, da Kedabeg schon
östlich vom Verbreitungsmeridian von Abies Nordmanniana und
Picea orientalis gelegen, dieses der Grund des Misslingens war. Den
Wäldern von Kedabeg wird in den letzten Jahren durch die
Benutzung des Masuts zum Ausschmelzen der Erze, ausgiebige Schonung
zu Teil. Hier haben wir rationelle Wirtschaft, soweit sie im Lande
möglich ist. Schon in nächster Nähe von dieser
Kulturstätte wird Missbrauch und Unfug überall geübt.
Wenig höher an der Baumgrenze waren die Rotbuchen alle verhackt.
Das geschieht im Kaukasus überall, wo -Nomaden mit den Herden im
Frühling auf die subalpinen Wiesen ziehen, wo in Folge der hohen
Lage die Flora anfangs nur sehr schwach entwickelt ist und die Tiere
Hunger leiden. Da sie aber nur die Spitzen der Äste, die Knospen
der jungen Blätter fressen und es mühsam ist, gesondert
solche Triebe zu sammeln, so schlägt man ganze, starke Äste
ab, lässt sie vom Vieh förmlich abweiden und dann liegen.
Dasselbe geschieht im Winter unten in den Ebenen, die zwar gewöhnlich
ausreichendes, junges Grünfutter den Herden darbieten, aber doch
in manchen Jahren längere Zeit eine Schneedecke tragen, dann
muss der Wald die Ernährung übernehmen. Dem Übelstande
ist schwer abzuhelfen. Solange hunderttausende von nomadisierenden
Familien als Grundbedingung ihrer Existenz die Wanderungen auf und ab
im Gebirge Jahr ein Jahr aus ausführen, wird der Wald an ihren
Lagerplätzen und auf ihren Wegen ruiniert. Nicht anders verhält
es sich mit den festen Ansiedelungen in den Wäldern,
gleichgültig in welcher Höhe sie liegen; so lange ihre
Herden zu jeder [p.:218] Jahreszeit überall im
Walde gehen dürfen, kommt kein gesunder Nachwuchs auf. Wo der
Andrang der wandernden Nomaden besonders stark ist, wie z. B. im
Karabaghgau, da verändert sich sogar der Charakter der
subalpinen Wiese, welche, wenn ungestört, das Urbild einer
üppigen, blumenreichen Au darbietet. Die Hochflächen
Karabaghs (1800—2450 m = 6—8000 r. F.) werden den
Wanderwegen entlang so systematisch verfressen, abgenagt und durch
die Hufe der Tiere festgetreten, dass den ausdauernden Gewächsen
eine kräftige Entwickelung nach oben gar nicht möglich ist
und sie deshalb ihr Wurzelleben ganz besonders stark ausbilden. Die
kaum zollhohen Polster von Oxytropis cyanea verwurzelten total, nur
scharfes Messer kann sie bezwingen. Auch die zerzausten Karikaturen
von Carpinus duinensis, entlang den Wegen, verdanken ihre bizarren
Formen und-den Wucher der enggedrängten Belaubung meistens dem
Ziegenfraß. Werden an ihnen die Endknospen abgefressen, wie das
von oben durch die kletternden Ziegen geschieht, so kommt der Strauch
nicht hoch auf, während er ungestört bis 30 Fuß Höhe
erreicht. In welchem Grade der Hunger das dürftig überwinterte
Vieh auf dem Wege zur Alm dazu treibt, Alles fort zu fressen, was nur
irgend wie erreichbar, dafür liefern die Paliurusgebüsche
die klarsten Beweise. Nur unter dem Schütze ihrer Stacheln
konnte die Frühlingsflora sich ausbilden, rund umher sehen wir
Alles bis auf j die Ranunkeln abgeweidet.
Aber
auch da, wo solche althergebrachte, orientalische Wirtschaftszustände
nicht statthaben, wo mit dem Andränge der Russen nach Süden
die indigene Bevölkerung sich teilweise oder ganz zurückzog
und der Nordfuß des Kaukasus mit Kosaken und Bauern besiedelt
wurde, sieht es mit dem Walde schlecht aus. Idealere
Naturverhältnisse für die landwirtschaftliche Existenz des
Menschen, als sie das Kubangebiet in seinem südlichen Teile
darbietet, kann man sich kaum vorstellen. Mächtig lagernde
Schwarzerde, viel Wasser, sanft aus der Ebene ansteigendes Gebirge,
in seinen Mittelpartien fast überall reinen, geschlossenen
Eichenwald tragend, höher Buchen, Rüstern und Nadelholz,
darüber alpine Weide und endlich schneeklüftiges
Hochgebirge mit Gipfelhöhen von 1800—3350 m (6—nooor.
F.). Überall hat diese Natur den Charakter urwüchsiger
Kraft, und dieser ist es zuzuschreiben, dass sie noch freigebig
leistet. An vielen Orten ist sie im Gebirge noch jungfräulich,
an anderen, wo seit der Mitte der sechziger Jahre die unterworfene
Bevölkerung fast ganz auswanderte, sind die Spuren ihrer
geringen Kultur fast ganz verschwunden. Wenn sich nun auch nach
verhältnismäßig kurzer Zeit die Misswirtschaft der
Kosaken noch nicht, was den Wald anbelangt, fühlbar macht, so
darf man sie deshalb doch nicht billigen. Mit eigenen Augen sah ich,
dass in den herrlichen Eichenwäldern auf dem Wege nach Maikop
vollkronige Stämme von 1 1/2—2 Fuß Durchmesser im
Sommer gefällt wurden, um von je einem ein Nutzholz in der Länge
von 10 Fuß auszuschroten und alles Übrige an Ort und
Stelle dann seinem Schicksale zu überlassen. Vom Auf- und
Abräumen des Waldes ist im Kuban-Gebiete nirgends die Rede,
selbst da nicht, wo das Holzgeschäft in hoher Blüte steht
und sehr beträchtliche Einnahmen bringt.
[p.:219]
Herr MAXIMILIAN NOSKA, ein gebildeter österreichischer
Forstmann, welcher längere Zeit als Jagdmeister das Revier des
Großfürsten sergei michailowitsch (477000 Desjt. = 5240
qkm) verwaltete (leider so früh und so tragisch umgekommen) hat
die Waldverhältnisse am Kuban in jeder Hinsicht richtig
geschildert (in der österreichischen Forstzeitung 1892). Er
schreibt unter Anderem: »Die Russen fanden 1864 herrliche,
unentweihte Waldungen, welche heute ein immenses Kapital
repräsentieren würden, vor. Die Aufsicht über diese
unermesslichen Komplexe fiel damals wenigen, ihrer Aufgabe nicht
entfernt entsprechenden Organen anheim, welche die ungesetzliche
Ausbeutung der Wälder selbstverständlich nicht hindern
konnten, ja eher ihr noch Vorschub leisteten. Der Wald war als
vogelfrei erklärt und Jedermann glaubte sich berechtigt, nach
Lust und Liebe darin wüsten zu können. Unmassen wertvollen
Materials fielen der Axt des Bauern zum Opfer, für welches er
dem Staate auch nicht eine Kopeke Zahlung leistete. So standen die
Dinge noch vor einem Decennium (Anfang der achtziger Jahre).
Allmählich regelten sich diese Verhältnisse mehr und mehr,
und wenn auch heute der Zustand in der forstlichen Organisation noch
viel zu wünschen übrig lässt, so ist doch bereits ein
guter Schritt nach vorwärts zu verzeichnen, wenngleich sich die
Sünden der Vergangenheit nicht mehr gut machen lassen.«
Und
weiter heißt es bei noska: »Wie schon erwähnt, hat
die Eiche (und zwar ausnahmslos Qu. pedunculata) in den Vorbergen (im
Hochgebirge auf sonnseitigen Lagen auch Qu. sessiliflora) die großen
Flächenteile auf den Ausläufern des Gebirges in reinen
Beständen inne, die heute noch, wo unberührt, das
herrlichste Wachstum zeigen. Sie imponieren weniger durch
Mächtigkeit, als durch denkbar prächtigsten, geraden und
vollholzigen Wuchs. Freilich gilt dies nur von den im vollen Schlüsse
befindlichen Beständen noch nicht angegriffener Teile. Die den
Ortschaften zunächst liegenden Eichenwälder zeigen dagegen
ein trauriges, abschreckendes Bild. Knorrige Überständer
wölben das Geäste trauernd über einer Wirrnis
bürstendick aufschießender Loden, die wieder, durch eine
rücksichtslose Waldweide und nicht weniger durch alljährlich
wiederkehrende Bodenfeuer in ihrem Wachstum behindert, sich nur zu
krüppelhaften Baumexemplaren entwickeln können.
Halbverkohlte Dürrlinge zeugen auf Schritt und Tritt von dem
Walten dieses Elementes.« Das Holz der kaukasischen Eiche soll
jedoch nicht von besonderer Güte und deshalb minderwertig sein.
— Da in den Wald das Vieh eingetrieben und zur Erzielung eines
besseren Graswuchses oder aus Mutwillen ein großer Teil des
Waldbodens jährlich abgebrannt wird, so zeigen diese
Gemeindewaldungen zum größten Teil ein desperates
Aussehen, insbesondere in nächster Nähe der Staniza, wo der
Kosak in Ermangelung besseren Materials — das brauchbare
Jungholz muss zu Zaunstecken herhalten — bereits
Kopfholzwirtschaft betreibt. Verkrüppeltes Oberholz, kümmernde
Jugend ist schonungslos der devastieren-den Hand der Kosaken
preisgegeben. Es hält schon schwer bei dem, besonders für
den Hausbau so vielfach benötigten Holzmaterial noch ein gerades
Stück zu finden, will man nicht stundenweit danach fahren, und
dieser Mangel [p.:220]
ist um so empfindlicher, je
stärker die Zunahme der Bevölkerung erfolgt, weshalb denn
der Preis des Holzes draußen im flachen Lande sich unglaublich
hoch stellt.
Gegenüber
allen diesen Schäden, welche der Mensch dem Walde zufügt,
kommen die, welche das Wild anrichtet, kaum in Betracht.
Erwähnenswert ist, sagt NoSKA, dass Rotwild durch Schälen
in Nadelhölzern gar nicht schadet und nur Laubhölzer,
besonders Aspen (Winterschälung) angeht. Mehr wäre der
Schaden, soweit man diese Bezeichnung in den Urwäldern überhaupt
gebrauchen kann, durch Schlagen starker Hirsche (ich fand
Kiefernhölzer im Umfange von 60—80 cm total geschlagen) und
das Fegen beachtenswert. Der Auerochs schält stark, am liebsten
Vogelbeeren, Ulmen, Linden, Eschen, doch selbst Tannen und Kiefern
fand ich (entgegen der Behauptung brehm's) von ihm geschält. Und
als Kuriosität mag desgleichen Erwähnung finden, dass der
Bär mannshohe Tännlinge, wenn er an die Bereitung seines
Winterlagers geht, abbeißt, von den Verwüstungen nicht zu
sprechen, die er in den Kronen wilder Obstbäume, Birnen, Äpfel
und Kirschen, sowie von Buchen, deren Nüsse im Herbst seine
Hauptnahrung auszumachen pflegen, anzurichten im Stande ist. Dabei
wird der Verbiss durch Hochwild kaum merkbar, einzig die Erle leidet
sehr darunter. Malbäume von Schwarzwild, vor allem harzige,
sporadisch eingesprengte Kiefern, findet der Jäger häufig
bis in die Felsregion hinauf. Aber auch der Bär hat, was gewiss
sehr wenig bekannt sein dürfte, seinen Malbaum 2—3 m
hoch über dem Boden, an welchem er sich reibt, und es sind diese
Stellen ebenso wie bei dem Schwarzwilde, wenngleich weniger intensiv
markiert.
Der
Verkauf des Holzes erfolgt ausschließlich auf dem Stocke, es
ist eine Art modifizierten Blockverkaufes und pflegt der hierbei
übliche Vorgang folgender zu sein. Der Forstverwalter stellt dem
Konsumenten ein »Billet« aus mit Angabe der Hiebmasse,
Spezifizierung des Sortiments, der allgemeinen Bestimmung des
Hiebortes und des Ausbringungstermines. Dieses Billet hat drei
Koupons, einen zur Kontrolle, der monatlich mit Rechnungsschluss dem
Revisionsbureau einzusenden ist, einen zweiten als »Prikas«
dem Forstschutzorgane der angewiesenen Datsche, der dritte verbleibt
als Dokument in den Händen des Forstverwalters. Die Bezahlung
erfolgt im Voraus. Der Konsument haut, falls nicht der seltene Fall
einer Auszeichnung der Stämme vorangegangen sein sollte, in dem
ihm zugewiesenen Teile nach Belieben. Die Beendigung des Hiebes zeigt
er der Forstverwaltung an, und nachdem die Kontrolle durch das
entsprechende Forstschutzorgan, nur bei besonders großen
Quantitäten durch den Revisor (der eine Reise von 500—600
km zu manchem Hiebsorte deshalb zu machen hat) oder den
Forstverwalter in eigener Person, durchgeführt, wird die
Bewilligung zur Ausfuhr erteilt. Ein Überhauen von einigen
Procenten ist gestattet, doch Nachzahlung erforderlich. Der Termin
wird streng eingehalten, das bis zum festgesetzten Tage nicht
genutzte oder ausgeführte Material verfällt dem Fiskus. Zur
Trift ist eine eigene Triftbewilligung nötig, mit ebenfalls
gegebenem Termin und unter gleichen Folgen, wofür man 5 % der
Ver- [p.:221] kaufssumme berechnet. Bei der
Kontrollmessung, wobei keine Kuppe in Verwendung tritt, kommt nicht
das gefällte, sondern nur das ausgeschrotete Holz in Betracht,
das andere bleibt als Abfall, »Brack« liegen, desgleichen
solche Stämme, die zwar gefällt, aber als nicht
konvenierend zurückgelassen wurden, wofür als Entschädigung
10% der. Verkaufssumme eingezahlt werden, desgleichen 3 %
für den Verbrauch von Brennholz zum Lagerfeuer der Arbeiter.
Unter diesen Umständen ist es natürlich, dass der Holzhauer
sich nur den besten Teil des Baumes erwirbt. Um den Wurzelanläufen,
die bei starken Exemplaren von nicht geringer Bedeutung sind,
auszuweichen, errichtet man nicht selten mehrere Meter hohe Gerüste,
um den Baum zu fällen, und wird dann nur das astreine Stück
ausgelängt. Der Verkauf erfolgt nicht nach dem Massengehalt des
Materials, sondern nach einer Tabelle, die für jede Stärke
einen bestimmten Preis festsetzt. So steigt z. B. der Preis bei
gleicher Länge und einem Durchmesser von über 16 Werschok
mit jedem Werschok um i Rbl., wobei nur das Zopfende gemessen wird.
Maßangaben
über die wichtigsten Holzarten. Diesen Mitteilungen«
gegenüber wird uns der Stand des jungfräulichen Urwaldes
gewiss durch die imponierende Kraft vieler seiner Individuen
erfreuen. Ich will daher jetzt eine ganze Reihe von Maßen
folgen lassen, welche den individuellen Wuchs der stärksten
Nadel- und Laubhölzer zur Anschauung bringen. Zunächst also
von den Plätzen im Kubangebiete, die wir soeben besprachen.
Das
Längenmaximum dürfte bei P. orientalis 60 m betragen. Nach
Versicherung von Holzhauern soll anderwärts eine Fichte in 70 m
Länge gefunden worden sein. Die der Tanne beigemischte Buche
dürfte als Maximum einen Durchmesser von 85 cm aufweisen. Unter
anscheinend gesunden, zur Fällung

[p.:222]
ausgezeichneten Stämmen waren ca. 50 % unten kernfaul, von
den unten gesunden gewiss 3/4 wipfeldürr und es dürften
unter dem stehenden, schlagbaren Holze kaum 3—5 % ganz gesunder
Exemplare sich gefunden haben. Bemerkenswert ist ferner, dass ich
Exemplare fand, die in der ersten Jugend ein so langsames Wachstum
aufweisen, dass ein Stamm im 80. Lebensjahre 6 cm, .ein anderer im
180. Jahre 20 cm stark war. — Alles dieses entnehme ich noska's
Arbeit.
Aus
demselben Gebiete, von der Laba, macht mir über den dunkelsten
Tann Herr JÜTHNER, der Nachfolger noska's als Jagdmeister des
Großfürsten sergei michailowitsch folgende Mitteilung:
Dieser
ungemischte Tannenforst (A. NordmannianaJ erstreckt sich in
dichtgeschlossenem Bestände zu beiden Seiten der Laba. Der
gleichmäßige Wuchs und die Vollholzigkeit der einzelnen
Stämme weist auf äußerst günstige Verhältnisse
hin. Das tiefgelegene, rings durch Hochgebirge geschützte
Thalbecken ließ den Tannenbestand zu außergewöhnlicher
Üppigkeit gedeihen. Es wurden folgende Maße ermittelt:
Höhe
des Stammes...... 64,05 m
Umfang
in Brusthöhe..... 4,52 m
»
bei 32 m Höhe (Mitte). . 3,23 m
Kubischer
Inhalt eines Stammes . 53 cbm.
Auf
einer Desjätine standen 15 solcher Kolosse und repräsentierten
einen Holzgehalt von fast 800 cbm.
Von
der großfürstlichen Domäne »Borshomc, auf
welcher der Wald sehr energisch und auch leidlich rationell
exploitiert wird, liegen viele Maßangaben über die
stärksten Bäume, ihr Wachstum, die Größe ihrer
äußeren Oberfläche, ihren Holzinhalt und ihren
jährlichen Zuwachs vor. Die Domäne wird von der oberen Kura
in einer Engschlucht von SW. nach NO. durchsetzt. Auf linker
Flussseite steigt das Gebirge rasch zur imeretischen Wasserscheide
an, auf rechter erhebt es sich als Randgebirge Hocharmeniens
langsamer bis zu 2 740 m (9000 r. F.). Von dem Gesamtareal (70000
Desjt. = 765 qkm) sind 50000 waldbestanden und zwar: Gemischter Wald
31665 Desjt., reiner Coniferenwald 14936 und reiner Laubwald 5629
Desjt. Von den drei Coniferen ist Picea orientalis die häufigste
und hat auch in der Vertikalen die größte Verbreitung
(700—2150 m =2300—7000 r. F.). Sie besteht entweder allein,
oder doch vorwaltend im gemischten Walde etwa 11 500 Desjt. Tiefer
Lehmboden, feuchte Luft und Erde fördern ihr Gedeihen, daher die
höheren Nordlagen, die Wände der Engschluchten und
Hochkessel vornehmlich von P. orientalis bestanden sind.
[p.:223]
Picea
orientalis.
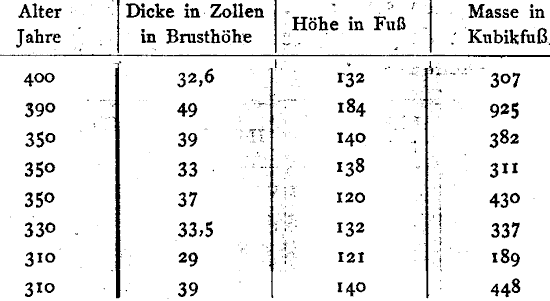
Der
Häufigkeit nach folgt auf die Fichte die Kiefer
Pinus
silvestris.
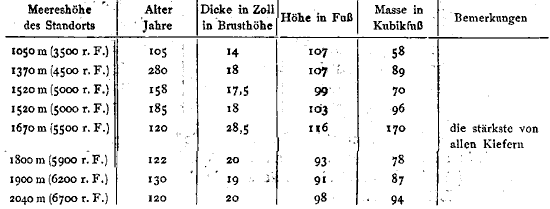
Als
dritte der Häufigkeit nach folgt Abies Nordmanniana 1050—2000
m = (35°°—6500 r. F.). Diese Edeltanne bevorzugt
kalkhaltigen schwarzerdigen Boden, was weder bei der Fichte noch bei
der Kiefer der Fall ist, daher ist sie auf kalkigem Boden vorwaltend
und zwar an den freien SSW.- und SO.-Seiten, aber bei genügend
feuchter Luft ohne große Feuchtigkeit des Bodens. Meistens
wächst sie mit der Fichte zusammen, ganz reine Stände sind
selten. Im Ganzen deckt sie 3600 Desjt. Auf allerbestem Boden wurden
folgende Maße am Schlagplatz genommen:
Abies
Nordmanniana.
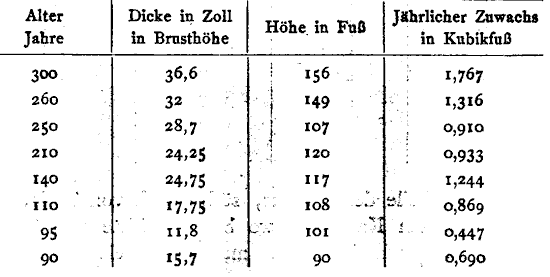
[p.:224]
In höheren Lagen gedeiht der
Baum besser als in tieferen. Die eben gegebenen Maße beziehen
sich auf Bäume aus der Zone von 1050—15010 m (3500—5000
r. F.). In denjenigen von 1600—1900 m (5300—6200 r. F.)
ermittelte man auf bestem Boden:
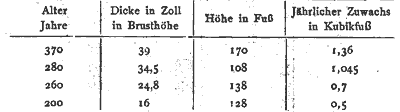
Die Maße der
allerstärksten Baume sind:
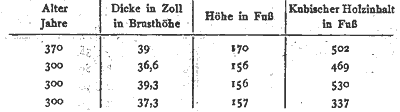
Ich
schließe hieran noch etliche Daten über die Rotbuche,
Fagus silvatica. Zum Teil in reinen Beständen, aber auch in
Gesellschaft von der Fichte und Weißbuche (Carpinus) wächst
sie am liebsten in den Senkungen und Kesseln mit frischem Lehmboden.
Fagus
silvatica.
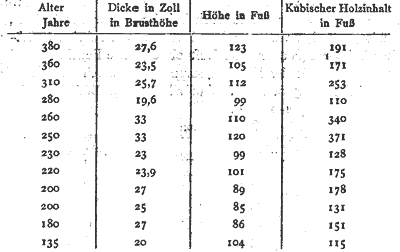
Aus
dem Centralteile des Isthmus, südwestlich von Tiflis, also
ebenfalls im sogenannten Kleinen Kaukasus, wo bereits Fichte und
Tanne ihre östliche Verbreitungsgrenze fanden, liegen mancherlei
belehrende Maße vor. Als
[p.:225] nämlich
vor zwei Jahren dort die Wälder der Güter des Fürsten
S. I. Melikow [Anm.:Die
Güter heißen: Sadachlo, Choshorni, Welati, Klein Uruty,
Zopi und Arabatala.] im Bortschalin'schen
Kreise (Chramfluss) taxiert wurden, ermittelte man auf 6 Besitzungen,
die einen Flächenraum von 4440 Desjt. einnahmen, folgendes:
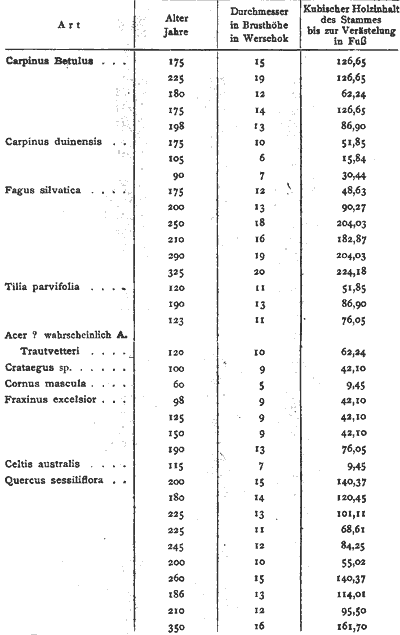
[p.:226]
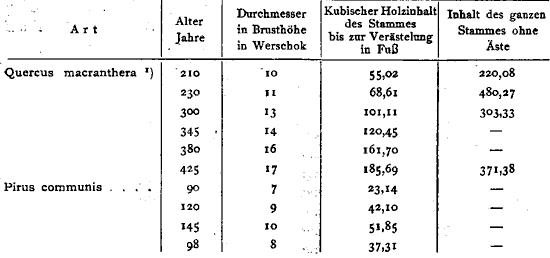
[Anm.:
Wahrscheinlich haben wir es hier mit dieser Art zu thun, welche an
manchen Stellen des Kleinen Kaukasus an der Baumgrenze wächst
und als Dickstamm vereinzelt in die subalpinen Wiesen tritt. ]
Die
Wälder der Domäne Borshom in wirtschaftlicher Hinsicht.
Die herrlichen Wälder der dem Großfürsten michail
nikolajewitsch gehörigen Domäne sind ganz besonders
geeignet, um daran Mitteilungen über die Art und Weise der
Bewirtschaftung der kaukasischen Wälder und ihrer Rentabilität
zu machen. Denn jedenfalls können uns die Wälder von
Borshom in dieser Hinsicht als bestes Beispiel im Kaukasus dienen, da
ihnen im Vergleich zu den Kronwäldern mit einem größeren
Verwaltungspersonal eine rationellere Bewirtschaftung zu Teil wird
und in Folge der großen Bedeutung für den Holzhandel die
Kura abwärts ihre Erhaltung und Pflege für die Zukunft von
ganz besonderer Wichtigkeit ist. Auch über die Feinde des
Waldes, die Herde des Insektenfraßes, über die
Ansiedelungen im Walde, deren Viehstand keinen Nachwuchs aufkommen
lässt, endlich über die zeitweisen Brände soll Einiges
gesagt werden. Ich folge hierbei teils den offiziellen Angaben,
welche im Jahre 1889 bei einer statistischen Beschreibung und
Taxation ermittelt wurden, teils den Angaben des Verwalters von
Borshom, Herrn ardasenow. Der Abschnitt über die schädlichen
Insekten wurde auf meine Bitte für dieses Werk von Herrn
WINOGRADOW-NIKITIN, dem Gehülfen des ersteren, einem
Spezialisten für dieses Fach, verfasst.
Über
die Größe dieser Domäne und den Umfang ihrer Wälder
gab ich schon oben p. 222 Auskunft. Das dort Angeführte ist zu
ergänzen: subalpine Wiesen über der Baumgrenze 13 507
Desjt., Waldwiesen 2005 Desjt, Ackerfelder 722 Desjt. Der Rest der
Oberfläche mit Ausschluss der Waldgebiete, welche rund 50000
Desjt. einnehmen (Summa der ganzen Domäne 69881 Desjt), kommt
auf die nicht benutzbaren Plätze, Steilfelsen, den Kura-lauf und
ihr wechselndes Schwemmland, auf den Tabizchuri-See und die Wege.
[p.:227]
In früheren Zeiten (bis 1859) war überhaupt von einer
regelrechten Bewirtschaftung gar nicht die Rede und die damals
entworfene Schlageinteilung mit ;e hundertjähriger Erneuerung
des Fällens kam nicht zur Ausführung. Man hieb nach Wahl
die besten Stämme, natürlich je bequemer, um so besser, und
kümmerte sich weder um die schwer zugänglichen Wälder,
noch um las Trocken- und Sturzholz, ließ auch alles, was vom
frischgefällten Starrm nicht wertvoll genug war, alles Geäste
und die Spitze der Bäume im Walde liegen. Es bildeten sich im
Verlaufe der Zeit immer mehr Fraßherde und Fraßnester der
Waldverderber, denen man anfänglich gar keine Aufmerksamkit
schenkte und deren Bekämpfung auch jetzt noch nur mangelhaft
betrieben .wird. Das hat auch seine großen Schwierigkeiten und
würde, wenn wirkich rationell durchgeführt, sehr große
Unkosten bereiten. Ein zweiter Übebtand für das Gedeihen
des Waldes und namentlich des Nachwuchses liegt darin, dass in den
Wäldern der Domäne 18 Dörfer gelegen sind, welche
durchschnittlich je 20 Feuerstellen, also etwa 360 Familien im Ganzen
sess-haft haben. Die Bevölkerung ist gemischt, es sind Grusiner,
Ossen und Klein-russm. Sie zahlen Grundpacht und arbeiten auf Lohn
beim Schlag und mit dem Vieh bei der Ausfuhr. Aber das Vieh, welches
im Walde weidet, lässt den Nachwuchs nicht aufkommen.
Anderweitigen Schaden verursachen die Waldbrände. Namentlich
sind sie zur Zeit des trockenen Hochsommers in den mehr oder weniger
geschlossenen Coniferen-Beständen gefährlich. Meistens
werden sie durch Nachlässigkeit verursacht,' da man die
gelegentlichen Nachtfeuer bei dem Verlassen der Ruheplätze nicht
ablöschte; doch auch aus Rache zünden unzufriedene Bauern
den Wald an. Im Ganzen rechnet man auf der Donäne 11 ooo Desjt.
verbrannten Wald. Das größte Feuer wütete im Herbst
1895, es zerstörte 6000 Desjt. Weithin lag Wald und Kurathal in
Rauch gehüllt. Zum Löschen sind nicht allein die Insassen
Borshoms und der Um-gegjnd verpflichtet, sondern es wird auch'das
Militär, Kosaken und Infanterie, dazi beordert. Endlich muss ich
der Stürme gedenken, die manchen Stamm zu Falle bringen. Dem
gesunden, geschlossenen Hochwalde im Gebirge können sie nicht so
leicht beikommen. Aber auf freier Straße, entlang der Kura,
rasen sie, wenn auch nur selten, mit voller Macht und zwar
thalabwärts zur heißen Sonmerzeit (auch im Juni 1896). Die
gestürzten und gebrochenen Stämme liegen in der Richtung
Achalzich-S'uram. Man nennt solche Stürme hier Cyclonen; ich
glaube nicht, dass sie wirklich in die Kategorie der Wirbelwinde
gehören, sondern vielmehr Stürme SW.-NO. sind, welche
unbehindert mit Veiemenz in die enge Schlucht des Kura-Durchbruches
stürzen. Schlimmer noch sind die höher im Gebirge bisweilen
einsetzenden Stürme, welche im Quadranten NO.-SO. rasen. Sie
treffen das tiefe Hauptthal der Kura nicht, wohl aber die
hochliegenden Terrassen z. B. von Bakuriani und Zichis-dshwari, und
richten dann großen Schaden an; so wurden 1876 im Verlaufe von
48 Stunden am 10. und ii. Oktober auf den genannten Lokalitäten
circa 50000 Stämme gestürzt. Auch bei der jetzigen
Bewirtschaftung der Wälder von Borshom hält man die
Einteilung nach Schlägen nicht ein. Man schont aber nach
[p.:228]
Möglichkeit den gesunden Wald, bemüht sich die
überstandenen, oft sehr aufgetrockneten Stämme und das
Sturzholz fortzuschaffen und den Wald wenigstens streckenweise zu
reinigen. Prinzipiell wird mit jedem folgenden Jahre weniger frisches
Holz geschlagen. Der Schlagpreis pro Stamm beläuft sich
durchschnittlich auf 30—50 Kopk., d. h. man bezahlt für
einen Balken, ohne Äste und Rinde bei vier Faden Länge am
Platze im Walde diesen Preis als Arbeitslohn. Der höchste Wert,
den ein Prachtstamm auf dem Holze haben kann, beläuft sich auf
7—10 Rbl., er hat einen dreifachen Wert als Balken, wenn er
gefällt und an die Eisenbahn oder an das Kuraufer gebracht
wurde. Solche Balken sind kerngesund und haben am oberen Ende einen
Durchmesser von 14—16 Werschok. Doch das sind jetzt schon
seltenere Ausnahmen. Den Mittelwert der Balken als Bauholz bei 4
Faden Länge muss man bei 8 Werschok oberem Dickende und ca. 40
Kubikfuß Inhalt, ä 20 Kop. den Kubikfuß, mit 8—i
o Rubeln am Platze des Exportes berechnen. An die Kura gebracht
koppelt man daraus Doppelflöße von je 10 Balken, diese
werden am Platze je nach der Dicke des Holzes im Mittel mit 200—300
Rbl., selten mit 400 und darüber bezahlt. Der Transport eines
Floßes die Kura abwärts bis Tiflis, ca. 150 km, kostet
25—30 Rbl. und die Preise am Holzmarkt von Tiflis sind von
200—600 Rbl. pro 20 Balken. Dabei ist zu bemerken, dass schon
während des Transportes das Holz durch 3 und 4 Hände geht,
da sich die Zwischenhändler mit geringem Profit begnügen.
Dieser
Handelsweg des Holzes von Borshom ist der bequemste und
frequentierteste. Ein zweiter führt von den Schlägen über
das Gebirge auf das waldlose Hocharmenien nach Achalkalaki. Der
mühsame Transport dorthin wird auf zweirädrigen, plumpen
Arben, je mit 6—8 Ochsen oder 4 Büffeln bespannt, über
den fast 2740 m (9000 r. F.) hohen Zchra-Zcharo-Pass ausgeführt
und findet nur im Sommer statt, weil im Winter (Nov. bis April) hoher
Schnee die Passage verhindert. Man gestattet nur Sturzholz nach Wahl
des Käufers auszuführen, das Gut hat dabei gar keine
Unkosten zu tragen. In neuerer Zeit wächst die Ausfuhr nach
Achalkalaki (reichlich 40 km) sichtlich. Sie belief sich 1895 auf
16000 Rbl., obgleich den Käufern am Platze der Einkaufspreis
höher gestellt wird, als den Lokalkonsumenten, so z. B. der
Kubikfaden Brennholz im Walde für Achalkalaki 6 Rbl., für
den Lokalkonsum nur 2—3 Rbl. Aus dem Walde aber zur Kura
gebracht kostet ein solcher Kubikfaden schon 15 Rbl. In Tiflis zahlt
man für dasselbe Maß bester Qualität Brennholz
folgende Preise: Nadelholz 22—25 Rbl., Rotbuche und Eiche 27—32
Rbl., Weißbuche, als das beste, 34—42 Rbl., mit
Hinstellung zur Wohnung des Konsumenten.
Die
gegenwärtige Gesamtproduktion der Domäne stellt sich in
runden Zahlen annäherungsweise folgendermaßen zusammen:
30
000 bis 40 000 Balken ä 4 Faden, für die man vornehmlich
die durch Insekten geschädigten und schon abgetrockneten Stämme
verwendet.
[p.:229]
400000 Kubikfuß Holz, namentlich Kiefern und Tannen von
überständigen Stämmen.
2—3000
Kubikfaden Brennholz verschiedener Qualität.
Das
Betriebsjahr 1895
brachte
ein 406 924 Rbl.
kostete
361 127 Rbl
Gewinn
45 797 Rbl.
Man
hat neuerdings ernsthaft an die Aufforstung der leeren Brandstellen
gedieht. Pro 1897 sind dazu 10000 Rbl. angewiesen und man wählte
dazu ein Grebiet ohne Viehgang. Die Erfahrung wird lehren, ob Saaten
oder Anpflanzungen sich bewähren. Mit beiden solchen Versuchen
wurden in den Wäldern von Kedabeg (SIEMENS Kupferhütte)
keine Erfolge erzielt. Aber man muss dabei bedenken, dass dieser Ort
bereits bedeutend östlich vom Grenzmeridian der beiden
kaukasischen Tannen gelegen ist. Die lukrative Zukanft dieser Domäne
liegt kaum mehr im Walde, welcher unter den jetzigen
Wirschaftsverhältnissen mit jedem Jahre mehr und mehr geschwächt
wird. Vielmehr liegt die Zukunft Borshoms in seiner Bedeutung als
Bade- und Villenort und namentlich in seinen Mineralwässern.
Letztere ersetzen, soweit sie bis jetzt benutzt werden, in der
Hauptquelle das Vichywasser mit geringer chemischer Differenz und ist
die Produktion desselben im Verlaufe von 4 Jairen bereits auf eine
halbe Million Flaschen gestiegen. Wenn auch augen-blictlich sich
diese Mineralwasserproduktion in Folge der hohen Preise der Flaschen,
welche aus Finland via Gibraltar und Batum an ihren Bestimmungsort
Borshom kommen, nicht rentiert, so unterliegt es doch keinem Zweifel,
dass durch die Errichtung einer großartigen Glashütte
(Privatunternehmen) und bei dem dadurch bedingten Fallen des Preises
für die Flasche um 2/3 ihres jetzigen Wertes, das Vichy Borshoms
in baldiger Zeit den eigentlichen Reichtum der Domäne
repräsentieren wird.
Diesen
Mitteilungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse
Borshoms füge ich zunächst einige Daten von ökonomischem
Interesse für alle kaukasischen Forstbezirke bei.
Nach
dem ministeriellen Berichte für das Jahr 1895 werden die
ökonomischen Verhältnisse aller Kronwälder durch
folgende Tabelle repräsentiert:
[p.:230]

Alle
Forstbezirke haben außer den Einnahmen vom Walde, die ich in
dieser Tabelle nur angebe, noch andere Revenuen, so z. B. im ganzen:
Gouv. Tiflis 122013 Rubel, Gouv. Kutais 43022 Rubel, Gouv. Stawropol
74439 Rubel u. s. w.
Schädliche
Insekten der kaukasischen, speziell der Borshomer Wälder (nach
dem russischen Originaltexte von WlNOGRADOW-NlKITIN) [Anm.:Die
Verantwortung für diese Mitteilungen übernimmt natürlich
der Antor, Herr WINOGRADOW- NlKITIN.]
Insekten,
welche den Wäldern des Kaukasus schaden, sind sehr zahlreich,
weil die Holzarten und ihre Wachstumsbedingungen im Kaukasus äußerst
verschieden sind. Die Raubwirtschaft in den Wäldern und ihre
grenzenlose Verunreinigung durch alle restierenden Abfälle geben
den schädlichen Insekten die Möglichkeit, sich in so hohem
Grade zu vermehren, dass an manchen Orten ganze Waldbezirke verseucht
werden und der Kampf mit den Feinden des Waldes absolut unmöglich
wird. Besonders groß ist der Schaden von Käfern aus der
Familie der Scolytidae, welche hauptsächlich dem Nadelholz,
besonders der Picea orientalis, die bösesten Feinde sind. Dieses
Übel vergrößerte sich in der letzten Zeit mancherorts
noch ungemein durch große, streckenweise wandernde Brände
der Nadelhölzer. Eine riesige Menge leicht versengter Bäume,
welche auf den Brandstätten, dank dem Mangel von Wegen und
Unternehmungsgeist, nicht entfernt wurden, gaben den Borkenkäfern
die Möglichkeit sich in ungeheurer Anzahl zu vermehren.
Stellenweise flogen dieselben förmlich in Wolken und überfielen
die Bäume in solcher Menge, dass man schon in einiger Entfernung
das Geräusch hören konnte, welches durch das Ausnagen der
Gänge unter der Rinde hervorgebracht wurde. Wegen Mangels an
Platz an den Stämmen krochen zuweilen mehrere Käfer einer
Art (10 und mehr) in ein einziges Bohrloch und bemühten sich,
gegenseitig sich [p.:231] störend, nach
verschiedenen Seiten auseinander zu gehen. Auf diese Weise wird der
Splint in radialer Richtung von der Eingangsöffnung ausgenagt
und bildet sogenannte fächerförmige Miniergänge,
welche besonders oft bei Tomi-cus sexdentatus Börner, T.
acuminatus Gyll. und T. bistridentatus Eich, angetroffen werden. Wenn
sich der Käfer unter der Rinde bis zu einem freien Platze
durchgenagt hat, wird der Miniergang beendet und es fängt der
Muttergang an, an dessen Seiten die Eier abgelegt werden. Öfters
kommt es vor, dass sich an dem Stamme solche freie Plätze nicht
mehr befinden, dann nagen sich die Käfer entweder in das Holz
bis 65 mm hinein, oder sie siedeln, nachdem sie ein Flugloch
ausgenagt haben, auf andere Bäume über. In solcher Weise
werden fächerförmige Miniergänge nur in dem Falle
ausgeführt, wenn die Zahl der Insekten sehr groß ist. Es
ist selbstverständlich, dass bei solchen Massenausflügen
von einer besonderen Auswahl geschwächter oder kranker Bäume
keine Rede sein kann. Ganze Waldbezirke, die gesund waren, kommen
dabei vollständig um. Die ersten Flüge machen
Versuchsanfälle und kommen, falls die Bäume zu saftig sind,
in dem ausfließen-den Harze um. Sie geben aber den folgenden
Flügen der Borkenkäfer die Möglichkeit, unter die
Rinde der nun schon geschwächten Bäume zu gelangen. Bei
solchen Massenausflügen überfallen die Borkenkäfer
Holzarten, die ihrer normalen Lebenweise gar nicht entsprechen. So
wurde z. B. Tomicus sexdentatus auf Taxus baccata und sogar auf
Laubholz gefunden. Dabei drang er unter der Rinde nicht weiter als
2—3 cm vor und wurde ein Opfer seines Versuches. Wenn die
Zahl der Käfer zur Flugzeit nicht besonders groß ist, so
werden, wenigstens bei dem Genus Tomicus, keine Miniergänge
angelegt, sondern es gehen die Insekten sofort an den Bau der
Muttergänge. Die Verbreitung der durch Borkenkäfer
vertrocknenden Bestände geschieht besonders schnell nach der
Richtung der herrschenden Winde zur Flugzeit der Käfer. Sehr oft
kann man in den Wäldern Streifen vertrockneter Bäume in
dieser Richtung beobachten, dabei fangen solche Streifen immer bei
Holzschlägen, kleinen Brandstrecken u. s. w. an. Besonders
empfindlich gegen Borkenkäferschäden erweisen sich die
Tannenbestände, da Picea orientalis, auf schattigem Boden
mittlerer und geringerer Güte wachsend, sehr empfindlich gegen
Veränderungen äußerer Wachstumsbedingungen ist. Die
geringste Unregelmäßigkeit im Holzschlagen, oder
Windbrüche, welche den Boden entblößen, setzen diese
Tanne dem Winde und der Sonne aus, wodurch sie kränkelt und so
dem Anfalle der Feinde zugänglicher wird, bald ganz vertrocknet
und von sich aus das Übel tiefer in den Bestand verbreitet.
Tomicus sexdentatus, der Hauptfeind der Nadelwälder, hat im
Jahre zwei Generationen. Es ist bemerkenswert, dass diese Art im
Kaukasus besonders gerne P. orientalis angreift, während die
europäische Tanne, P. excelsa, soviel mir bekannt ist, von
diesem Borkenkäfer nicht überfallen wird. Gewöhnlich
geht unser Baum schon im Verlaufe von 2—3 Wochen ein.
Besonders umfangreiche Verwüstungen der Tannenwälder
befinden sich in den Kreisen: Gori, Achalzich und Scharo-pan und die
Zeit ist sicherlich nicht mehr fern, in der die Tanne in diesen
[p.:232] Kreisen
zu den selteneren Bäumen gezählt werden wird. Der Schaden
durch Tomicus sexdentatus wird noch durch den Umstand vergrößert,
dass aufiler den Muttergängen noch Miniergänge angelegt
werden, welche oft in das feiste Holz bis 65 mm. tief eindringen und
dadurch die technische Qualität dies Holzes beeinträchtigen.
Diese Miniergänge werden nach den Frühjahrs- uind
Herbstflügen gewöhnlich gleichzeitig mit den Muttergängen
angelegt. E!e-sonders häufig geschieht dies bei gleichzeitigen
Massenausflügen der Käfer nach einem kalten Frühjahr
oder regnerischen Sommer, denen warme, günstige Tage folgen. Die
Miniergänge gehen anfangs, wie schon gesagt, strahlenförmiig
vom Bohrloche aus, einige von ihnen können bei günstigen
Bedingungen sich zu Muttergängen entwickeln, gewöhnlich
aber werden sie weiter und weiter in verschiedenen Richtungen
fortgesetzt, durchkreuzen sich, erreichen bis 50 c:m Länge und
an ihrem Ende bohren sich die Käfer ins feste Holz ein, wo i sie
größtenteils umkommen. Solche Miniergänge kommen aber
niemals vor, we:nn die Käfer sofort günstige Bedingungen
zur Errichtung regelmäßiger Muttergänge finden. Bei
diesen befindet sich das Bohrloch stets am unteren Ende,
wahrscheinlich um bequemer das Bohrmehl hinauszustoßen. Man
kann nach der Lage des Bohrloches bestimmen, ob die Käfer den
stehenden Baum überfielen, oder am bereits gefällten Stamme
ihre Arbeit begannen. Beim Bohrloch wird die Rammelkammer ausgenagt,
von welcher 3—5 Muttergänge ausgehen, dabei führt
gewöhnlich am stehenden Holz blos ein Gang nach oben, alle
übrigen dagegen nach unten; dagegen auf liegenden Bäumen
ohne Unterschied alle entweder nach oben oder nach unten. Dieses
Merkmal ist sehr wichtig, um Missbräuche in denjenigen
Wirtschaften aufzudecken, wo ausschließlich todtes Holz
gefällt werden soll. In allen Fällen folgt der Muttergang
der Richtung der Längsfasern und nur auf stark gewundenen Bäumen
beobachtete man eine Abweichung von 45° von der vertikalen
Richtung. Die Länge des Mutterganges erreicht bis 17 cm, die
Zahl der abgelegten Eier Ibis 108, gewöhnlich werden nur 60—80
abgelegt. Von einer Familie, bestehe: nd aus einem Männchen und
drei Weibchen kann sich im Verlaufe eines Jahres eine
Nachkommenschaft von 10000 Käfern entwickeln. In den
Muttergängen werden in einer Entfernung von 6—7 cm
Luftlöcher ausgenagt, augenscheiin-lich dazu, um nicht das
Bohrmehl aus dem Bohrloche hinauszuschaffen. Seltener als die Tanne
überfällt Tomicus sexdentatus die Kiefer und Pinus
halepensis und noch seltener Abies Nordmanniana. Das Vorkommen
diesses Käfers auf Taxus baccata und auf Laubholz ist sicherlich
nur zufällig, weil die in diesen Bäumen abgelegten Eier
umkamen und keine Nachkommenschaft lieferten. In den reinen
Tannenbeständen wütet der Käfer entsetzlich, der Wald
von Wardewani auf der Domäne Borshom wurde auf einer Fläche
vion 600 Desjt. ganz vernichtet, es gab da keinen einzigen grünen
Baum meltir. Und doch war in diesem Walde niemals Brand gewesen, noch
wurde daselbst Holz geschlagen. Die Käfer wanderten zu ihm von
den einige Kilomelter entfernten Wäldern des Fürsten
zizianow, welche in den letzten Jahren dur ch Waldbrände stark
gelitten hatten. In der Vertikalen steigt Tomicus sexdein- [p.:233]
tatus im Gebirge bis zur äußersten Grenze der Verbreitung
des Nadelholzes. Die große Verbreitung dieses Borkenkäfers
veranlasste einige Wirte, das Schlagen von frischem Holz vollständig
einzustellen und nur totes Holz zu fällen. Als Mittel zur
Bekämpfung dient schleuniges Aushauen der verseuchten Bäume
und Abschälen der Rinde vor dem Ausschlüpfen der neuen
Generation, die Äste werden in Haufen gelegt und verbrannt. In
den Wäldern von Abas-tuman wurden die restierenden Stöcke
mit Kalkwasser begossen. Solche Mittel werden aber nur in den besser
bewirtschafteten Wäldern angewendet, gewöhnlich überlässt
man anderweitig die verseuchten Wälder ihrem Schicksale, es
wirken dann in solchen die von der Natur geschaffenen Feinde der
Borkenkäfer, verschiedene Vögel und Raubinsekten (Ips,
Colydidae, Ichneumonidae etc. Als Hauptvertilger erscheinen mittlere
und kleine Spechte, Meisen u. a. Von Käfern vertilgt Nemosoma
die Eier der Borkenkäfer. Auf der Domäne Borshom belief
sich der Schaden von Tomicus sexdentatus 1893 auf 40000 Stämme
[Anm.:
Dieser Schaden wurde im folgenden Jahre durch eine unqualifizierbare
Maßregel der damaligen Verwaltung fast verdreifacht. Man
wollte, wie das in geregelter Wirtschaft geschieht, sogeiannte
»Fangbäume< herrichten. Mit einem Aufwande von loooo
Rbl. wurden 43000 gesunde Bäume gefällt. Sie thaten ihren
Dienst. . . Aber im Frühjahre löste man von ihnen die Rinde
nicht. Man hatte also die Borkenkäfer nur vermehrt, 10000 Rbl.
ausgegeben und 40003 gesunde Bäume vernichtet!].
Myelophilus
minor Hart, und piniperda L. verursachen auch sehr bedeutenden
Schaden, weil sie oft die erste Ursache der Schwächung der
Kiefern sind, indem sie die Kronen sowohl der alten, als auch der
jungen Bäume vernichten. Es ist interessant, dass M, minor im
Kaukasus sich auch un:er der Rinde von Picea orientalis sehr stark
vermehrt und dabei ganz regelmäßige Muttergänge
bildet. Besonders umfangreiche Verwüstungen wurden von diesem
Borkenkäfer in dem Jungholze des Bezirkes Tetrobo-Tschebortschai
der Kronforstei von Achalkalaki angerichtet. Verhältnismäßig
unbedeutender Schaden wurde von ihm in last allen Kieferwäldern
unseres Landes bemerkt. Der Flug geschieht sehr früh, früher
als bei allen übrigen Borkenkäfern, nämlich schon Ende
März und Anfang April, 1895 wurde der erste Massenflug arr.
ig./'31. März beobachtet. Höher im Gebirge verspätet
gewöhnlich der Flug, Auf lebenden Stämmen bildet
Myelophilus minor stets senkrecht zu den Fasern stehende Muttergänge
mit dem Bohrloch nach unten. Auf liegenden Holze sind die Muttergänge
verschieden angelegt und befindet sich das Bohrloch auf ganz
entgegengesetzten Stellen. M. piniperda baut auf stehendem Holze den
Muttergang stets senkrecht über das Bohrloch, auf liegendem ist
die Richtung sehr verschieden. Die erstere der beiden Arten bevorzugt
meistens denjenigen Teil des Kiefernstammes, welcher eine rötliche
dünne Rinde besitzt, während die letztere die stärkere
schwarzbraune Rinde bewohnt.
Tomicus
bistridentatus Eichh., T. bidentatus var. (beta) Eichh. und T.
acuminatus Gyll. bewohnen hauptsächlich die Äste und Kronen
der Kisfer, Tanne und Fichte, die letztere der drei Arten wurde auch
an [p.:234]
Stämmen bis 70 cm Durchmesser angetroffen. Auf Picea orientalis
kommen alle drei Arten vor. (Fraßstücke befinden sich im
Museum zu Tiflis). Der erste Flug dieser Käfer findet Ende April
und Anfang Mai statt, der zweite Ende August und Anfang September.
Die Gänge haben alle einen sternförmigen Typus, außerdem
fertigt bei ungünstigen Verhältnissen T. acuminatus
fächerförmige Miniergänge an, welche am Ende ins Holz
bis zu einer Tiefe von 1,5 cm eindringen. Diese Tomicus-Arten sind
dem Jungholz während der trockenen Jahreszeit besonders
schädlich, wenn die Bäume keinen großen Saftgehalt
haben. Im Gebirge gehen sie bis 2280 m (7500 r. F.) hoch hinauf und
T. acuminatus wurde sogar noch höher gefunden. Verhältnismäßig
geringen Schaden verursacht Tomicus longicollis Gyll., welcher
gewöhnlich kranke Kiefern anfallt. Sein Flug geschieht im
Herbst, den Winter verbringen die Käfer unter der dicken Rinde
abtrocknender Kiefern, wo sie zusammen mit T. laricis F.
unregelmäßige Miniergänge ausnagen. Interessant sind
auch die Miniergänge vom unlängst beschriebenen T.
spinidens Reitt. auf Picea orientalis und P. silvestris; sie werden
gewöhnlich fächerförmfg angelegt und bestehen aus 6—15
Strahlen von 6—8 cm Länge. Die Strahlen haben an den Seiten
Ausbuchtungen, wie die Gänge von T. acuminatus Gyll.,
wahrscheinlich zu dem Zwecke, damit die Käfer sich ungehindert
umdrehen können. Diese Art überfällt alle drei
Coniferen an geschwächten Exemplaren. Der Flug findet im Mai
statt. Die Muttergänge, 4—7 an der Zahl, gehen zuerst
sternförmig von der Rammelkammer aus, später stehen sie
senkrecht zu den Fasern des Baumes, erreichen eine Länge von 7
cm und haben stellenweise seitliche Erweiterungen. Die Zahl der von
einem Weibchen abgelegten Eier beträgt bis 130. Die Larvengänge
erreichen bis 3 cm Länge und endigen in der bis 3" mm ins
Holz eindringenden Wiege. Diese Art wurde in den Wäldern von
Borshom und Achalzich beobachtet.
Pityophthorus
micrographus L. und Cryphalus saltuarius W ei ss e infizieren dünne
Teile der Bäume, hauptsächlich von Picea orientalis,
seltener trifft man sie auf Ab. Nordmanniana und noch seltener auf
der Kiefer. Ersterer hat im Kaukasus nur eine Generation im Jahr und
fliegt im Juni. Auf frisch gefällten Bäumen überfällt
P. micrographus auch dicke Balken. Diese Verschiedenheit in der
Flugzeit der Borkenkäfer giebt die Möglichkeit, recht genau
die Hauzeit zu bestimmen, was besonders wichtig ist zum Entdecken von
unerlaubtem Holzfällen. Wenn z. B. auf den gefällten Bäumen
Myelophilus minor oder piniperda ihre Gänge gebaut haben, so
kann man daraus richtig schließen', dass diese Bäume vor
dem März gefällt wurden; wenn Tomicus sexdentatus
beobachtet wird, so war der Baum vor dem Mai gehauen und endlich,
wenn Pityophthorus micrographus angetroffen wird, so wurde der
betreffende Baum bis zum Juni gefallt. Die Rammelkammer des letzteren
wird in der Rinde angelegt, die Muttergänge, bis 7, werden
sternförmig unter der Rinde genagt und greifen den Splint an,
sie erreichen 5 cm Länge. Die Zahl der Eier ist in jedem Gange
bis 60, die Larvengänge haben eine Länge von 1,5—2 cm.
Dieser Borkenkäfer wurde in allen Nadelwäldern des
Gouverne- [p.:235] ments Tiflis und Kutais beobachtet.
Cryphalus saltuarius überfällt ausschließlich dünne
Teile von Tannen und Fichten, seltener findet er sich auf Kiefern und
in Ausnahmefällen wurde er auf Juniperus communis var. reflexa
gefunden, wo er ganz regelmäßige Gänge baute und sich
vermehrte. Muttergänge existieren bei dieser Art nicht. Es wird
gewöhnlich eine unregelmäßige Fläche ausgenagt,
an deren Ränder die Eier abgelegt werden. Die Larvengänge
sind radial angelegt, sie kreuzen sich zuweilen und sind bis 45 cm
lang. Dieser Borkenkäfer überfällt kranke Zweige,
Jungholz u. s. w. Die Gänge fangen gewöhnlich neben Wunden
oder Rissen der Rinde an, er ist häuptsächlich in der
Schlucht von Borshom zu finden. Auf absterbenden und beschädigten
Ästen von P. silvestris trifft man auch Carphoborus minimus F.
an, er fliegt Ende Mai und hat eine einjährige Generation, die
Muttergänge sind von sternförmigem Typus und erreichen eine
Länge von 3 cm. Die Zahl der abgelegten Eier überschreitet
gewöhnlich 15 nicht in jedem Gange, die Larvengänge stehen
nicht dicht und sind nur 1,5 cm lang. Verbreitet ist diese Art
hauptsächlich im Kreise Achalzich, wo sie bis 1830 m (6000 r.
F.) Höhe vorkommt.
Hylastes
ater Payk., H. attenuatus Er., H. angustatus Hbst. und Hylurgops
palliatus Gyll. trifft man fast ausschließlich in den Stöcken
der drei Coniferen an, der zuerst genannte geht auch auf Taxus
baccata und verhindert den Wuchs von Schösslingen, was in
Hinsicht auf die Abnahme dieser wertvollen Holzart durch Aushauen
sehr wichtig ist.
Noch
müssen Xyleborus cryptographus Retz und Xyloterus lineatus Öl.
erwähnt werden, welche im Kaukasus vorkommen, und obgleich sie
den lebenden Bäumen keinen Schaden zufügen, so verursachen
sie doch einen sehr bemerkbaren technischen Nachteil am gefällten
Nadelholz. Diese Käfer bohren sich nämlich bis 15 cm tief
in dasselbe und bauen dort ihre Leitergänge. Es wurden Fälle
beobachtet, in denen auf einem Quadratfuß Oberfläche des
Balkens bis 150 Bohrlöcher vorhanden waren. In diese Löcher
dringt schnell die Feuchtigkeit und damit Fäulnis in das Innere
des Balkens ein und machen ihn zu vielen technischen Zwecken ganz
unbrauchbar. Um die Balken vor dem Überfall dieser Käfer zu
schützen, wird die Rinde sofort nach dem Fällen abgeschält,
und findet dennoch ein Anfall der Käfer statt, so ist er nur
geringfügig. In den Wäldern Borshoms sind die Genannten
häufig, ihr Flug findet Ende April bis Anfang Mai statt.
Auf
Juniperus, Biota orientalis und Cupressus schadet Phloeosinus bicolor
Brll., er hat jährlich zwei Generationen, die erste im Mai, die
zweite im August. Die Muttergänge sind zweischenkelig nach der
Länge der Fasern gerichtet, jeder Gang wird bis z cm
lang, die Larvengänge bis 4 cm, gewöhnlich überschreitet
ihre Zahl 15 nicht. Auf dem Gebirgskamme von Wachang wurde dieser
Käfer auf Juniperus nana in einer Höhe von beinahe 2600 m
«500 r. F.J gefunden. In niedrigeren Lagen schadet er besonders
den angepflanzten Thuja und Cypressen, zumal in der trockenen
Jahreszeit.
[p.:236]
Laubholz wird von Borkenkäfern hauptsächlich aus der
Gruppe der Scolytini beschädigt. In den meisten Fällen
fangen die Verletzungen an einzelnen Teilen des Baumes, an
verwundeten Ästen, Kronen u. s. w. an. Betula alba wird in den
höheren Regionen (1520—2280 m — 5—7500 r. F.) von
Scolytus Ratzenburgi Jans, angegriffen. An einigen Orten, z. B. auf
dem Trialetkamme, ist dieser Käfer so verbreitet, dass nicht
eine Birke zu finden ist, die durch ihn nicht geschädigt wurde.
Der Umstand, dass die Birke dort stark durch Schneefall, durch Winde
und bei dem Weiden vom Vieh verletzt wird, vergrößert das
Übel. Die Art fliegt im Juni, ihre Generation ist einjährig.
Die Ulmus-Arten werden durch eine recht große Anzahl von
Scolytus sp. heimgesucht. Sc. Geoffroyi Goeze ist der Feind von Ulmus
montana und U. campestris, jährlich fliegen von dieser Art zwei
Generationen, eine Anfang Mai, die andere im August. Dieser Käfer
wurde häufig in der Schlucht von Borshom bis zu 1220 m (4000 r.
F.) Höhe beobachtet. Er wählt gewöhnlich die dicken
Stammteile von Ulmus montana und U. campestris. In den höheren
Regionen von 1220—2130 m (4—7000 r. F.) wird diese Art
durch Sc. laevis Chap. ersetzt. Letzterer hat eine einjährige
Generation und fliegt im Juni. Die Muttergänge haben am Anfange
eine Erweiterung, sind stets nach oben über das Bohrloch
gerichtet und erreichen eine Länge bis 8 cm. Die Zahl der
Larvengänge beträgt bis 160, sie haben bis 7 cm Länge
und endigen mit einer Wiege, die im festen Holz mit einer Tiefe von 1
cm gelegen ist. Bei ungünstigen Verhältnissen macht das
Weibchen an mehreren Stellen verkürzte Muttergänge, welche
dann weniger als 1 cm lang werden und 3—5 Eier enthalten. Solche
verkürzte Muttergänge haben in den meisten Fällen
nicht die charakteristische Erweiterung am Anfange. Häufig gehen
auch vom Bohrloche zwei Muttergänge, der eine nach oben, der
andere nach unten, aus. Die Gänge werden gewöhnlich an
schadhaften Stellen, Rissen, Wunden, angelegt. Die Arbeit der Larven
nimmt bald einen immer größer werdenden Raum ein und
verursacht ein teilweises Vertrocknen des Baumes. Dank diesem
Umstände trifft man in den Wäldern von Borshom und
Achal-zich eine sehr große Anzahl von beiden Ulmus-Arten mit
vertrockneten Kronen. Eben auf diesen Bäumen, aber nur an den
dünnen Ästen und Zweigen findet man Scolytus pygmaeus F.,
Sc. Kirschi Seal, und Hylesinus vitta-tus F. Diese Arten haben im
Kaukasus jährlich zwei Generationen und sind überall
verbreitet. Besonders hat Ulmus campestris an trockenen Standorten
von ihnen zu leiden. Höher als in 1220 m (4000 r.F.) wurden sie
nicht beobachtet. Carpinus Betulus wird von Scolytus carpini Retz.
angegriffen, welcher gewöhnlich die geschwächten Stämme
und Äste überfällt. Die Muttergänge, senkrecht zu
den Fasern des Holzes angelegt, sind 3—4 cm lang. Die
Larvengänge (bis zu 60), bis 9 cm lang, sind immer parallel den
Fasern. Die Puppenwiegen befinden sich im Holze 5—6 mm tief.
Jährlich entwickeln sich zwei Generationen, die erste im April
und Anfang Mai, die zweite im August, Bis zu 1050 m (3500 r. F.) Höhe
ist die Art in den Wäldern Borshoms verbreitet. Verhältnismäßig
selten wird Scolytus intricatus Retz. angetroffen,
[p.:237]
welcher die horizontalen Gänge unter der Rinde dicker Eichen
anlegt. Die Fruchtbiume, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen,
werden von Scolytus rugu-losus Retz. und Sc. pruni Retz. angegriffen.
An gesunden Bäumen verursachen beide Gummi-fluss, geschwächte
Stämme und junge Anpflanzungen können durch sie ganz
vernichtet werden. Sc. rugulosus greift gewöhnlich die dünnen,
Sc. pruii die dickeren Teile der Bäume an, der erstere geht bis
zur Grenze der Obstwildlinge, bis 22to m (7500 r. F.), der letztere
nur bis 1220 m (4000 r. F.). Sc. rugulosus greift auch Sorbus
aucuparia, Cotoneaster pyracantha und multiflora, sowie Crataegus
melanocarpa an; er hat jährlich zwei Generationen, Sc. pruni nur
eine. Als Schutzmittel wird in einigen Gegenden da» Bestreichen
der Stämme mit Lehm und Mist uid zuweilen mit Naphtharückständen
angewendet.
Alle
Ahornarten werden von Scolytus aceris Knotek angegriffen. Flugzeit
desselben im Juni; nur eine Generation. Die Muttergänge stehen
senkrecht und erreichen bis 6 cm Lange, oft sind sie abgekürzt.
Die Larvengänge, bis 120, sind sehr regelmäßig und
durchkreuzen sich niemals, die verkürzten Muttergänge haben
zuweilen nur 3—4 Larvengänge, die Wiegen liegen bis 5 mm
tief im Holz. Der Käfer lebt auf allen Teilen der Ahorne bis in
1520 m (5000 r. F.). Meereshöhe. In den Borshomer Wäldern
wurde er auf Acer campestre, A. laetum, A. platanoides und
A.Traut-vetteri angetroffen und überfällt gewöhnlich
unterdrückte, windbrüchige Bäume. Wir geben beistehend
die Abbildungen von zwei Fraßstücken, welche von Acer
campestre genommen wurden .(Borshorn).
Frsxinus
excelsior hat seine Feinde in Hy-lesinus fraxini Panz., H. oleiperda
F. und PhloeotribuS caucasicus Reitt. H. fraxini nagt oft die
Miniergänge in das Korkgewebe der Rinde und greift nach und nach
das lebende Gewebe an; nachdem dieses getötet wurde, baut
er
im Holz horizontale Muttergänge. Seine Flugzeit ist Anfangs Mai
und Mitte August, bis 1830 m (6000 r. F.). H. oleiperda fliegt
während des ganzer Sommers. Dieser Borkenkäfer wurde auf
Ligustrum vulgäre, Olea
|

|
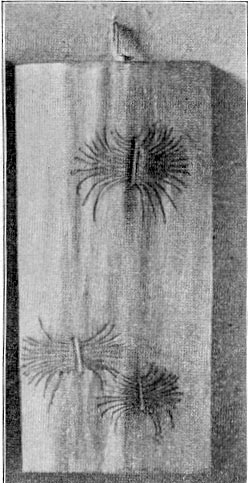
|

|
|
Fig. 6. Fraßgänge
von Scolytus aceris auf Acer campestre.
|
Fig. 7. Fraßgänge
von Phloeotribus caucasicus auf Fraxinus excelsior.
|
Fig. 8.Taphrorchus
Bulmerinqui Koln, auf Carpinus Betulus
|
[p.:238]
europaea und Syringa beobachtet und zeichnet sich durch sehr
lange Muttergänge aus.
Phloeotribus
caucasicus greift die dünnen Eschenzweige an und entwickelt
meistens seine Gänge an der Basis der Endknospen, sie haben eine
hakenförmige Form und werden bis 2 cm lang, bis 60 Eier,
die Larvengänge, welche sich gewöhnlich nicht durchkreuzen,
werden bis 3 cm lang, zwei Flüge im Frühjahr und im Herbst.
Die Art wurde nur bis 1050 m (3500 r. F.) Höhe beobachtet Auch
von dieser Art geben wir ein Fraßstück in Abbildung, es
stammt von Azchur.
Die
Linde wird von Erno-porus caucasicus Lindm. angegriffen, welcher
horizontale Muttergänge von unregelmäßiger Form
macht. Die Larvengänge, 2—3 cm lang, werden
gewöhnlich zwischen den Bastfasern angelegt; fliegt im August
und hat nur eine Generation.
Noch
muss Taphrorychus Bulmerinqui Koln. erwähnt werden, der sowohl
auf der Nordseite des Kaukasus, als auch in Transkaukasien sehr
verbreitet ist. Gewöhnlich greift er Carpinus Betulus an. Die
Muttergänge werden anfangs sternförmig, später
senkrecht zu den Holzfasern angelegt. In diesem letzteren Teile des
Mutterganges, der eine Länge bis 3 cm erreicht, werden die Eier
bis zu 35 abgelegt, die Larvengänge bis 6 cm lang gehen
zwischen den Fasern der Rinde. Der Käfer entwickelt jährlich
zwei Generationen.
Viele
Sträucher besitzen ihre eigenartigen Borkenkäfer. So z. B.
findet man auf Clematis Vitalba Xylocleptes bispinus Duft, mit
jährlich nur einer Generation. Es ist interessant, dass die
Käfer zum Winter sich in das Mark der jungen Triebe einnagen und
im Frühjahr nach dem Fluge Muttergänge von unregelmäßig
sternförmiger Form anfertigen, die Larvengänge haben die
Richtung der Bastfasern und drücken sich wenig auf dem Splint
ab. Die Wiege wird im Holz 1—2 mm tief angelegt. Ebenso
verbringt einen Teil seines Lebens Hypoborus ficus Er. im Mark der
Stengel von Ficus carica, er hat nur eine Generation und'fertigt
zuweilen außer den Muttergängen auch [p.:239]
fächerförmige Miniergänge an. Er kommt gleich
seiner Nährpflanze nicht höher als in 600 m (2000 r.F) vor
und wurde in den Gouvernements Kutais, Tiflis, Jelisa-betpol und Baku
beobachtet. Kissophagus hederae Schmidt lebt auf Hedera helix und H.
colchica und bildet horizontale Muttergänge. Zum Schluss noch
die Nachricht, dass ein interessanter Borkenkäfer, Hylastinus
Trifolii Müll., auf dem Strauche Cytisus biflorus lebt. Seine
Gänge sind hakenförmig unter einem sehr spitzen Winkel zu
einander gerichtet. Die Länge eines 'jeden Astes des
Mutterganges beträgt bis 4 cm, die Zahl der Eier bis 35. Die
Larvengänge sind nach verschiedenen Seiten gerichtet und messen
bis 5 cm. Was die Schäden durch verschiedene andere Insekten
anbelangt, so kommen sie für die forstwirtschaftliche Praxis
hier zu Lande als nur gering nicht in Betrag. In der Kronforstei von
Karajas wurde auf Eichen Ocneria dispar beobachtet und standen dort
die Bäume in der zweiten Hälfte des Sommers 1895 fast ganz
ohne Laub. Psilura monacha L. wurde in einzelnen Exemplaren bei
Lagodechi auf Laubholz und .im südlichen Daghestan auf Kiefern
angetroffen. Lasiocampa pini L. kommt vereinzelt in fast allen
Kiefernwäldern des Kaukasus vor. Cossus cossus L. greift in
beträchtlicher Zahl Populus tremula an. Übrigens hat dieser
Baum in den meisten Wäldern noch keine technische Verwendung
gefunden. Hylesinus vestitus kommt auf Pistacia mutica vor und Lytta
vesicatoria vernichtet oft in bedeutendem Umfange das Laub von
Fraxinus excelsior, so z. B. in dem Kronwalde von Schirach. Von den
Aphidien müssen Chermes orientalis Dreyf. und Ch. funitectus
Dreyf. erwähnt werden; sie verursachen das krankhafte
Anschwellen der jungen Knospen von Picea orientalis.